Als ich erwachte, war Philipp längst aus dem Haus. In der ganzen Wohnung fand ich Zettel verstreut, auf die er Liebesbeteuerungen geschrieben hatte. Zum Nikolaus schenkte er mir eine CD mit einer beigelegten Liebeserklärung. Er sei bei den Liedern ganz bei mir und verknüpfe mit ihnen intensive Erlebnisse. Die Lieder besäßen die Macht, ihn aus der Einsamkeit in eine andere, glücklichere Welt zu versetzen, in der er mir ganz nahe sei. Es seien Lieder, bei denen er weinen oder auch lächeln müsse, weil sie sein Leben erhellten. Er wolle diese Lieder mit mir teilen. Ständig versuchte er, mir zu erklären, dass die schwierigen Phasen in unserer Beziehung bald enden würden. Er spüre mit jedem Tag mehr die Freiheit nahen und er wolle nichts anderes mehr als diese Freiheit. Die Gefangenschaft seiner Ehe habe ihn krank, kraftlos und oft hoffnungslos gemacht. Er wisse, dass er diese Phase bald überwunden haben werde, sogar schneller, als es möglich erscheine. Doch es war zu spät. Zu lange hatte er mich vor verschlossenen Türen stehen lassen und zu lange wurde mein Sehnen und Hoffen nach einer Zweisamkeit nicht erhört. Ich konnte und wollte einfach kein Verständnis mehr dafür aufbringen, dass meine einstigen Träume von einer allumfassenden Beziehung voll Vertrauen und Geborgenheit plötzlich auch die seinen wurden. Dass er diese Träume jetzt verwirklicht sehen wollte. Weil er nun von Tag zu Tag mehr wisse, mich aus tiefstem Herzen zu lieben. Um Weihnachten herum war Philipp an einem Wendepunkt angelangt. Er blicke voller Zuversicht nach vorn in eine Zukunft in Freiheit, wie er sagte. Sein Weihnachtsgruß an mich war die Botschaft, dass er glücklich sei, er selbst sein zu dürfen. Er hielt weiterhin an seinen Träumen fest. Sie seien dazu da, so lange an sie zu glauben, bis sie Wirklichkeit werden würden.
Aus ›Nur geträumt?‹ von Christine Lackner
Zu Weihnachten hatte ich einen Plattenspieler bekommen. Einen Musikus 105V von Telefunken. Ausgelegt für Stereo. Man brauchte bloß noch einen zweiten Verstärker für den anderen Kanal. Das alte Radio mit dem Holzchassis war dafür ideal. Mit einem Adapter für die Bananenstecker musste es klappen. Die Bands wurden jetzt zahlreicher. The Kinks: ›Sunny Afternoon‹, ›You Really Got Me‹. The Troggs: ›Wild Thing‹. The Small Faces: ›Tin Soldier‹, intensives, absolutes Durchdrehen. Dieses ruhige Piano-Intro und dann treibendes Losheizen, diese Kraft, diese Energie, unglaublich. Überhaupt war alles englisch und »The«. Dann die Beachboys. »Bababa, bababaranne, babaraaanne ...« Amerikanisch und trotzdem gut, dachten wir. Mit ›Good Vibrations‹ spielten sie dann endgültig in der ersten Liga.
Wir veranstalteten des Öfteren private Hitparaden-Nachmittage. Da wurden Songs nach einem ausgeklügelten Beurteilungssystem bewertet. Der Gesang, die Komposition, das Arrangement, wilde Soli, die Message oder, was wir dafür hielten, wurden von uns mit Kennermienen einer strengen Prüfung unterzogen. ›My Generation‹ von The Who gegen ›Bus Stop‹ von The Hollies. Da ist die Fragestellung schon Makulatur. Natürlich überwogen wilde Soli und die Message bei den Who. Es wurde über die restlichen Kriterien noch gestritten, aber es gewannen die Who. Obwohl der mehrstimmige Gesang von den Hollies schon eine Klasse für sich war.
So verlebten wir die Tage im Rausch der Musik, wenn auch ab und zu Oma Prank in den Keller kam und zeterte: »Mog disse Negermusik mol lieser!« Sie war mehr in der Heideröslein-Ecke zu Hause.
Aus ›Leben ist ein Nebenjob‹ von Uwe Prink
»Weihnachten. Die Tage kannst du vergessen. Natürlich triffst du während der Feiertage auf reichlich dankbare Kundschaft. Natürlich auch auf die ganzen Irren. Aber denen kannst du eh nicht entkommen. Wenn sie dich finden wollen, dann finden sie dich früher oder später.« Charly blinzelte Oliver schlecht gelaunt zu. Oliver wich seinem Blick aus.
»Calvin mag es nicht, wenn man unangemeldet in seinem Revier fischt. Warte mal lieber, bis er dich anquatscht«, sagte Charly.
Oliver schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht vor, in seinem Geschäft mitzumischen. Bestimmt finde ich selbst etwas. Zumindest, bis ich wieder in Berlin bin.«
»Ja, sicher. Rede dir das nur schön ein. Ohne die richtigen Papiere oder festen Wohnsitz steht dir natürlich die Welt offen.«
»Ich habe Papiere. Das krieg’ ich schon hin.«
Charly zuckte mit den Schultern. »Wie du meinst, mein Freund. Du weißt ja, wo du uns findest, falls nicht.«
Oliver schlug die Augen nieder. Zu selbstsicher blickte der andere auf ihn hinunter. Er versuchte, die wenigen fehlenden Zentimeter auszugleichen, indem er seine Wirbelsäule durchstreckte. Doch sein Kopf brummte. Diese Anstrengung würde ihm auch nicht weiterhelfen. Er sehnte sich nach einem Kaffee. Irgendein anderes warmes Getränk würde ihm auch schon genügen.
Aus ›Olivers Reisen‹ von Sigrid Lenz
Sie schloss die Tür hinter sich und fütterte als Erstes alle Katzen, die aus den verschiedensten Ecken und Winkeln und über das geöffnete Kippfenster beim Klappern der Futternäpfe auftauchten. Während sie fraßen, zündete Alicia Öllampen und Kerzen an und machte Feuer im Kamin. Schließlich schlüpfte sie in einen kuscheligen Jogginganzug. Darüber zog sie sich einen langen Wollpullover an. Jetzt fühlte sie sich wohler. Sie setzte sich an den steinernen Kamin und wartete, dass das Feuer richtig zu brennen begann. Das Holz war etwas feucht und es dauerte ein Weilchen, bis sich die Flammen im Kamin ausbreiteten. Alicia wärmte sich ein wenig die Hände. Dann stand sie auf und ging mit der Taschenlampe wieder hinaus. Sie führte Alissaya in den Stall, gab ihr Futter und Wasser, legte ihr eine Decke auf den Rücken und unterhielt sich noch ein bisschen mit ihr. Sie fütterte auch ihr anderes Getier und rief schließlich den Hunden zu: »Veni, veni, zittilli [kommt, kommt, Kinder], jetzt gibt’s Bescherung!« Woraufhin die Hunde schneller im Haus waren als ihr Frauchen. Alicia machte fünf Dosen ihres Lieblingsfutters auf. Diese stürzten sich auf ihre Näpfe, als hätten sie noch nie in ihrem Leben etwas zu fressen bekommen und schmatzten um die Wette. Wie immer nach der Mahlzeit rülpste die cremefarbene Kira von Herzen. Die Tiere legten sich zufrieden auf ihre Decken, um ein Verdauungsschläfchen zu halten.
Alicia begann nun, ihr eigenes Festtagsmenü zuzubereiten. Sie setzte sich vor das Holzfeuer und schnipselte frisches Gemüse in den Wok, den sie auf den metallenen Dreifuß über die Glut gestellt hatte. Ein leckeres Currylammragout auf Wildkornreis sollte es zur Feier des Tages geben. Sie hängte einen großen, schwarzen Kessel angefüllt mit Wasser an einen Haken über das Feuer, um den Reis darin zu garen. Zwischendurch musste sie immer wieder das Feuer schüren, damit es nicht ausging. Während sie das Fleisch schnitt, stellte sie fest, dass sie viel zu viel davon gekauft hatte. Aber die Hunde und auch die Katzen fraßen sowieso immer mit. »Und der Rest ist für morgen«, dachte sie laut und warf das Fleisch in den Topf. Sie schüttete Gewürze hinein und deckte den Topf zu, um das Ragout über der roten Glut schmurgeln zu lassen.
Sie ging um den niedrigen Marmortisch herum, setzte sich ermüdet auf das Sofa und stellte das Radio an. Weihnachtslieder schallten ihr entgegen, die von Werbeeinschaltungen der großen Supermärkte mit den allerletzten Einkaufsempfehlungen für das große Fest unterbrochen wurden. Die korsische Version von ›Oh du Fröhliche‹ ertönte und plötzlich flossen Alicia Tränen über das Gesicht. Sie wischte sie verärgert weg und sagte laut: »Ich werde jetzt nicht sentimental werden!«
Aus ›Wurzeln der Hoffnung‹ von Miluna Tuani
Susan holte ihr Geschenk hervor, und als Danny das Papier zerriss, kam das T-Shirt zum Vorschein, das sie mit mir zusammen gekauft hatte.
»American Werwolf ...? Ey, ich seh’ nicht so bescheuert aus wie der in dem Film. Danke«, meinte er belustigt. Ob er das Shirt wirklich mal anziehen würde, war fraglich.
Ohne Worte schob ich ihm mein Geschenk hin. Er sah kurz zu mir, aber ich wich seinem Blick aus. Ich hatte mich dazu entschieden, ihm genauso gleichgültig gegenüberzutreten, wie er es bei mir tat. Und hoffentlich würde er merken, dass es kein sonderlich gutes Gefühl zur Folge hatte, wie Luft behandelt zu werden. Nachdem er mein Geschenk ausgepackt hatte, setzte er die Sonnenbrille auch gleich auf. Sie stand ihm ausgezeichnet, aber ihm jetzt ein Kompliment zu machen, kam nicht infrage. Mochte gut sein, dass sein Geburtstag war, aber ich hoffte, durch mein Verhalten eine Entschuldigung zu bekommen. Nicht dafür, was er gestern gesagt hatte, sondern wie er mich daraufhin behandelt hatte. Ich akzeptierte es durchaus, dass er nicht mehr als Freundschaft wollte, auch wenn es für mich enttäuschend war, aber dass er mich am Abend dauerhaft ignoriert hatte, wollte ich nicht so hinnehmen.
»Ha! Ich hab’ doch gesagt, die steht ihm klasse!«, sagte Susan stolz über ihre Auswahl.
»Jetzt kannst du zumindest rausgehen, ohne einen Augenschaden zu bekommen«, warf Shane ein.
Danny nahm die Sonnenbrille wieder ab. »Danke, Jade.«
Er bekam jedoch außer einem leichten Nicken keine Antwort von mir. Shane gab als Nächster sein Geschenk ab. Es war ein Buch über Werwolf-Legenden. »Da hast du bestimmt einiges zu lachen«, meinte er grinsend.
»Ja ich glaub’s auch. Danke«, antwortete der Werwolf schmunzelnd und blätterte kurz durch die Seiten des Buches.
»Tja. Mein Geschenk passt nicht hier rein. Da müssen wir schon rausgehen«, sagte der Professor und stand auf. Neugierig folgten wir ihm zum Eingang. Bevor wir rausgingen, hielt er seinem Pflegesohn die Augen zu.
Aus ›Die Hunde des Todes‹ von Anke Kaminsky
Mehr lesen: HIER


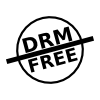
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen