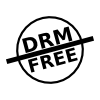|
| Weihnachtsmarkt am Spittelberg in Wien |
Donnerstag, 23. Dezember 2010
Dienstag, 21. Dezember 2010
So weit die Füße tragen – durch den Schnee
Leben ist ein Nebenjob von Uwe Prink
Roman
426 Seiten
ISBN: 978-3-9502871-2
Leseprobe
Kapitel 33
Schneekatastrophe
So weit die Füße tragen
Cindy kam jetzt mit dem Firmenwagen nach Hause. Unser Audi hatte ja beim Unfall einen Totalschaden erlitten. Nachmittags begann es zu schneien und wir freuten uns über den Schnee. Wir kochten uns heißen Punsch und fühlten uns ganz wohl in unserem kleinen Haus, in dem die Öfen ordentlich gefüttert wurden und behagliche Wärme ausstrahlten.
In der Nacht wurden wir durch Sirenengeheul geweckt, das sehr nah zu sein schien. »Das ist doch bei uns vor der Tür«, sagte Cindy und ich stand auf, um aus dem Wohnzimmerfenster zu sehen. Schon in der Küche gewahrte ich einen hellen Lichtschein. Das schräg gegenüberliegende Gebäude, das eine Wurstfabrik beherbergte, brannte lichterloh. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr waren in klirrender Kälte bei der Arbeit. Glücklicherweise war das Haus zu weit entfernt, um uns zu gefährden. Nach einigen Stunden hatten sie das Feuer gelöscht und zogen wieder ab.
Am nächsten Morgen kam Cindy, die das Haus gerade auf dem Weg zur täglichen Fron verlassen hatte, überraschenderweise nach zwei Minuten wieder zurück. »Das musst du dir mal angucken.«
Der Creativshop-Wagen war direkt vor der Fleischfabrik geparkt und wies jetzt eine Eisschicht von circa fünfzehn Zentimeter Dicke auf. »Gefrorenes Löschwasser«, stellte ich fest, »den kannst du erst wieder benutzen, wenn es getaut hat.«
»Scheiße, jetzt muss ich mit dem Bus fahren. Wer weiß, wann ich dann in der Firma bin.«
»Ja und bei dem Schneetreiben fließt der Verkehr auch nicht wie sonst.«
»Heute muss ich unbedingt nach Hamburg, ich wollte doch noch bei meiner Mutter vorbei. Die jammert mir schon tagelang die Ohren voll, weil sie wieder Ärger mit ihrem österreichischen Seemann hat.« Es war gar nicht so selten, dass die Schluchtenscheißer sich für diesen Beruf entschieden.
»Der Arsch macht nur Mist und sie schickt ihn trotzdem nicht zum Teufel. Irgendwie hat sie auch selbst Schuld. Na ja, es ist halt meine Mutter.« Sie entschwand zur Bushaltestelle und ich betrachtete das immer stärker werdende Schneetreiben. Die Lage wurde dadurch noch verschärft, dass ein eisiger Wind blies, der dafür sorgte, dass sich der Schnee an manchen Stellen des Deiches türmte. Laufend fuhren Schneepflüge, um die Straßen befahrbar zu erhalten. Das sah mir verdächtig nach Sisyphusarbeit aus.
Ich kochte mir eine Kanne Tee, frühstückte und machte mich daran, den Weg zum Schuppen, in dem sich der Heizöltank für die Öfen befand, freizuschaufeln. Ein bisschen Spaß machte mir dieser Ausnahmezustand schon, denn er brachte Farbe in meinen Alltag. Als ich mächtig gegen das immer stärker werdende Schneetreiben angeschaufelt hatte, war das Gefühl beim Trinken einer heißen Hühnerbrühe wohliger als sonst und ich dachte: »Die hast du dir jetzt redlich verdient.« Wie köstlich konnte so eine Brühe doch munden, wenn man vorher geackert und gefroren hat.
Selbst am Tag war es draußen nicht richtig hell. Im Haus war es dadurch sehr düster. Gegen Abend überlegte ich mir, was ich für mich und meine Süße kochen sollte und wartete auf ihre Heimkehr. Dass sie eine Stunde überfällig war, war bei dem Wetter noch normal. Zwei Stunden später war sie immer noch nicht zu Hause. Jetzt fiel mir auch auf, dass schon seit Langem kein Bus mehr vorbei gefahren war. Zum ersten Mal bereute ich es, kein Radio zu haben. Ich wusste nicht, was Sache war. Wahrscheinlich war der Verkehr zusammengebrochen. Nichts fuhr mehr. Ich kombinierte, dass meine Kleine bei ihrer Mutter in Hamburg-Eimsbüttel geblieben war, und richtete mich auf eine einsame Nacht ein. Das nächste Telefon befand sich nicht weit vom Haus entfernt. Ich wollte zumindest wissen, dass bei Cindy alles im grünen Bereich war, und war zudem neugierig über ihren Kenntnisstand der Situation.
Ich stapfte durch den Schnee zum öffentlichen Fernsprecher. Durch den Wind war es saukalt. Ich warf das Geld ein und wartete. Nach kurzer Zeit war mein Engel schon am Telefon. Sie hatte schon auf meinen Anruf gewartet.
»Scheiße, ich komm’ hier nicht mehr weg«, sagte sie genervt, »und wenn das so weitergeht, dann morgen erst recht nicht.«
»Ist Charly da?«
»Nein, der hat wieder angeheuert und meine Mutter überlegt jetzt, ob sie ihn endgültig in die Pampa schickt. Sie hat die Nase voll von dem Suffkopp.«
»Na ja«, wollte ich mich selbst beruhigen, »solange noch ein paar Lebensmittel und Wein da sind, werd’ ich’s überleben ohne dich. Aber Sehnsucht habe ich jetzt schon.«
»Ich auch, mein Schatz. Es ist höhere Gewalt. Vielleicht möchte das Schicksal uns mal zeigen, wie es ist, wieder allein zu sein.«
»So als kleine Warnung, wenn wir uns streiten und ich mir denke, was soll ich eigentlich bei der dusseligen Kuh. Also, lass dich nicht von deiner Mutter nerven und sei froh, dass Charly nicht da ist.«
»Ja, Schatz, ruf morgen wieder an.«
»Mach’ ich, tschüs.«
»Tschüs.« Ich legte auf und trollte mich. Erst einmal einen Punsch und was zu essen war jetzt die Devise. Als ich satt war und der Alkohol ins Blut stieg, ging es wieder los. Dieses Mal konnte ich mir das gut erklären, denn ich fühlte mich unendlich allein und ausgeliefert. Erklärung hin, Erklärung her, die Nacht war furchtbar. Ich versuchte bei Licht zu schlafen, weil ich dachte, dass mich im Dunkeln die Dämonen abholen. Mit rationalen Gedanken war dem nicht beizukommen. Die Angst und das Unbehagen waren schlimmer.
Am nächsten Morgen öffnete ich die Haustür und sah statt der Straße nur weiß. Und was ich sah, war keine weiße Straße, sondern eine weiße Wand. Der Schnee hatte sich bis zur Dachrinne aufgetürmt.
Mit einem »Ach du Scheiße«, stürzte ich zur Hintertür, die zum Garten und zum Schuppen führte. Hier war es möglich, hinauszugelangen und wieder einen Weg zum Schuppen zu bahnen. In weiser Voraussicht hatte ich Schaufel und Schneeschieber gleich neben der Tür zum Garten deponiert. Den Weg zum Schuppen freizuschaufeln war ein schlimmes Geacker. Ich füllte die Tanks der Ölöfen vorsichtshalber randvoll. Beim Frühstück dachte ich mir, noch so eine Nacht muss ich nicht noch einmal haben. Aber das Chaos war perfekt. Wie sollte ich hier wegkommen? Fuhren in Hamburg überhaupt Bahnen und Busse? Und wenn ja, dann ab wo? Mit der Bahn konnte ich erst ab Altona wieder weiter fahren. Ich musste also zwangsläufig den Bus nehmen. Der Gedanke, hier wegzukommen, schmolz dahin. Die Straßen waren bei diesem Chaos am schwierigsten frei zu halten. Ich musste erst wieder telefonieren.
Cindy konnte Nachrichten hören und fernsehen. Ich erfuhr von ihr, dass Panzer eingesetzt würden, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. Die Busse würden teilweise fahren, aber in Richtung Altona erst ab der Ortsmitte von Finkenwerder. Ich schluckte und sagte ihr, ich würde es trotzdem versuchen. Mein Vorhaben bedeutete, dass ich mich circa fünfzehn Kilometer durch den Schnee kämpfen musste. Ich wusste aber nicht, was mich am Elbdeich erwartete, wo das Land offen war. Der Schneesturm wurde hier nicht durch Bebauung abgemildert. Im Frühling hätte ich über diese Entfernung gelacht und mich sicher sofort auf den Weg gemacht. Bei diesem Unwetter musste man sich schon besser vorbereiten. Auf der anderen Seite wollte ich auf keinen Fall noch eine Nacht allein verbringen und außerdem war die Sache auch eine Herausforderung.
Ich erinnerte mich an Fernsehreportagen, die sich mit Polarforscher- oder Bergsteigerthemen befassten und wusste, dass ein Mensch in der Kälte viel Energie verliert. Also packte ich mir viel Schokolade und Kekse ein. Cindy hatte sich einen kleinen Schokovorrat angelegt, den ich jetzt plünderte. Dann kochte ich eine Kanne Tee und goss sie in die Thermosflasche. Von der Bundeswehr besaß ich noch lange, olivfarbene Unterhosen, und den Parka hatte man nach der Wehrdienstzeit auch behalten dürfen. Im Nachhinein war die Truppe doch noch zu etwas gut. So ausstaffiert und mit dicken Socken und Winterstiefeln machte ich mich auf in die Kälte.
Oben auf dem Deich, im Schutz der Häuser, konnte man ganz gut gehen. Vereinzelt versuchten Leute, ihre verschneiten Einfahrten freizuschaufeln. Ein älterer Mann, den ich nur vom Sehen kannte, fragte mich: »Wo wiss du denn hin, mien Jung?«
»Ich geh nach Hamburg.« So ein erstauntes Gesicht hatte ich schon lang nicht mehr gesehen.
Jemand fragte mich, ob ich zum Krämer wolle, der hätte nicht mehr viel zu bieten und ob ich etwas bräuchte. Die Menschen waren plötzlich wie ausgewechselt. Es herrschte eine Atmosphäre von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Warum braucht ihr erst eine Katastrophe, um das Maul aufzukriegen? Wäre doch nett, wenn es immer so wäre, dass man sich um den anderen kümmert. Ich lehnte mich gegen den Wind und ging weiter. Kurz vor dem Ortsausgang nahm ich einen kräftigen Schluck Tee und aß einen Riegel Schokolade. So, Junge, nu’ wird’s heftig.
An der Elbe machte ich Bekanntschaft mit Sankt Püsterich. Die einzige Möglichkeit durch zu kommen war, sich auf dem Deich zu bewegen. Die Verwehungen hatten die Straße bis auf halbe Deichhöhe geschluckt. Ab und zu schaute ein Autodach aus dem Schnee heraus. Panzer mit Schneeschiebern kamen mir entgegen. Wer sein Auto nicht akkurat am Straßenrand abgestellt hatte, musste damit rechnen, eine beschädigte Karre vorzufinden. Hier oben zu gehen, glich dem Waten durch brusthohes Wasser. Es stürmte heroben heftig, aber es war wie gesagt die einzige Möglichkeit vorwärts zu kommen. Unten war Tiefschnee, man wäre vollkommen darin versunken und möglicherweise von Panzerketten erfasst worden.
Ich musste an die Expedition von Amundsen und Scott denken und kam mir dabei lächerlich vor. Du gehst hier durch zivilisiertes Gebiet und die Jungs waren buchstäblich am Arsch der Welt. Völlig auf sich allein gestellt. Was für Helden. Was für ein Kraftakt. Aber was hatte sie angetrieben, so etwas zu tun? Die Gier nach Ruhm oder die Neugier des Entdeckers? War es die Herausforderung gewesen, die Natur zu besiegen? Was für ein Irrsinn war dieser Gedanke im Angesicht der begrenzten menschlichen Möglichkeiten. Scott hatte die Arschkarte gezogen, weil er glaubte, mit Pferden durchzukommen. Amundsen hatte ganz klar auf Hundeschlitten und Ski gesetzt. Seine Herkunft und seine Erfahrungen waren ihm hierbei von Vorteil gewesen.
Ich teilte meine Wanderung in Etappen ein. Erste Etappe: bis zum Ortsausgang Cranz. Die hatte ich genommen und befand mich jetzt auf der Geraden bis zur ersten Kurve.
Lange Geraden haben die schlechte Angewohnheit, unendlich zu erscheinen. Mein Ziel rückte zu langsam näher. Das Dunkelgrau des Himmels vereinigte sich mit dem grauen Wasser der Elbe zu einer konturlosen, übergangsfreien Masse.
Der Rotz aus meiner Nase floss auf meinen Schnurrdiburr, den ich über der Oberlippe trug. Erinnerungen an die Kindheit wurden wach, als ich den sogenannten »Schnodder« einfach wegleckte. Das ging doch ganz gut. Man ersparte es sich, die Handschuhe auszuziehen und kriegte keine kalten Hände.
Die zweite Etappe ließ ich hinter mich und bog auf die lange, schnurgerade Strecke zum Ortseingang von Finkenwerder ein.
Was musste der Alte in Russland erlebt haben! Wenn er sein Rendezvous mit Väterchen Frost nicht abgebrochen hätte, als er im Schnee gelegen hatte, verwundet durch einen Granatsplitter im Handgelenk, wäre ich heute nicht hier.
Er hatte mir erzählt, dass er damals immer müder geworden und schon über die Frierphase hinweg gewesen war. Es hatte ihm schon nichts mehr wehgetan. Aber der Wille zum Überleben hatte ihm geholfen, sich weiter zu schleppen, bis er bei seinen Kameraden war. Bei der Aktion hatte er seine Hand verloren. Sie war nicht mehr zu retten gewesen und musste amputiert werden.
Meine Sorgen wirkten bei diesen Gedanken geradezu winzig. Wir Kinder des Wirtschaftswunders waren doch im Vergleich zu diesen Menschen Weicheier.
Stapf, stapf, stapf. Schritte zu zählen, war langweilig.
»Geh meditativ«, sagte meine innere Stimme. Ich hielt nur kurze Zeit durch, dann kamen die Gedanken wieder zurück. Vielleicht klappte es mit einem Mantra.
»Om-go, om-go, om-go«, das lullte einigermaßen ein. Um nicht zu viel Energie zu verschwenden, flüsterte ich es leise vor mich hin. So hatte ich die dritte Etappe genommen.
Der Ortseingang von Finkenwerder beendete meine Meditation. So, mein Kleiner, jetzt noch einmal alles geben. Warum müssen diese verfluchten Dörfer bloß so elend lang sein? Bis zum Ortskern waren es noch einige Kilometer.
Die nächste Assoziation in meinem kalten Schädel befasste sich mit einem der Straßenfeger des 60er-Jahre-Fernsehens. Der Film bestand aus mehreren Teilen und handelte von der Flucht eines deutschen Soldaten aus der russischen Gefangenschaft. Der Titel war ›Soweit die Füße tragen‹. Bei jeder Folge dieses Streifens waren die Straßen leer gefegt wie bei der WM. Ich versuchte mir zum Zeitvertreib die Handlung ins Gedächtnis zu rufen, was mir aber nur weniger gut gelang.
Wie glücklich mussten die Bewohner von Finkenwerder, die an der Hauptstraße wohnen, doch in diesen Tagen sein. Kein Lärm, kein Gestank durch Autoverkehr. Diese Straße war sonst so stark frequentiert wie die B 73, eine der meistbefahrenen Bundesstraßen Deutschlands. Lebensqualität konnte ich mir hier unter normalen Umständen nicht vorstellen. Ich wünschte den Anwohnern noch viele ruhige Tage.
Der Ortskern rückte langsam aber sicher näher. In einigen Hundert Metern Entfernung meinte ich, eine Menschentraube zu sehen. Als ich näher kam, gerann mein Wunsch, der Vater dieses Gedankens, zur Realität. Die Leute warteten auf einen Bus. Hoffentlich kam zuerst der 150er nach Altona.
Die Wartenden waren in Gespräche vertieft und lachten. Jeder hatte etwas zu erzählen, ich sah freundliche Gesichter. Auf mich machte das den Eindruck, als wäre ich in einem südlichen Land.
Im Bus ging es genauso zu. Was war mit den Menschen passiert? Ich war immer kommunikativ im Bus. Manchmal wurde ich wie ein Alien angeguckt, weil ich wildfremden Leuten etwas zu sagen hatte. Besonders die Männer reagierten erstaunt und maulfaul. Möglicherweise fragten sie sich: »Ist der schwul?«
Jetzt redeten sie alle. Und ihre Gesichter bewegten sich sogar. Sonst waren Mimik und Gestik rar. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Mitreisenden würden unter peripherer Fazialislähmung leiden. Da waren nur versteinerte, traurige Gesichter der Menschen, die unter dem täglichen Trott litten, sich aber scheinbar damit abgefunden hatten. Unbeseelte Hüllen auf dem täglichen Gang nach Canossa, die sich jeden Tag erniedrigten in einer entfremdenden Tätigkeit. Buckelnd vor den Bossen. Erfüllungsgehilfen für eine glücklichere Welt, an der sie nie teilhaben werden. Doch sie bekamen diese bessere Welt jeden Tag im Fernsehen vorgesetzt.
Der einzige, unwahrscheinlichste Weg, der Fron zu entfliehen und auch in der Welt der Schönen und Reichen leben zu können, war der Lottoschein, den ich immer den »proletarischen Strohhalm« nannte. Leise sang Springsteen in meinem Kopf.
»Early in the morning, factory whistle blows,
man rises from bed and puts on his clothes …«
Jetzt, da ich die fröhlichen Menschen sah, wurde mir bewusst, dass auch ich so versteinert werden könnte und beschloss, diesem grauenhaften Trott soweit wie möglich zu entgehen.
Altonaer Bahnhof. Die Bahnen fuhren. Nach einiger Zeit tauchte ich an der Osterstraße aus dem Untergrund auf und ging die letzten Schritte zum Hellkamp, so hieß die Straße, in der meine zukünftige Schwiegermutter wohnte. Ich bedankte mich bei irgendeiner höheren Macht und drückte auf den Klingelknopf. Selten war ich so froh, meine Liebste zu sehen und sogar meine Schwiegermutter. Wer kann das schon von sich behaupten.
Im Folgenden bekam ich Vollversorgung: Heiße Suppe, Rumgrog und einen Platz zum Liegen auf dem Sofa inklusive einer wärmenden Decke. Es durchfloss mich ein heißes Glücksgefühl, das aufgrund seiner Intensität kaum zu ertragen war. War das schön.
Im Fernsehen verfolgte ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Dörfer waren eingeschneit, es gab Stromausfälle und außerhalb der Metropolen war der Verkehr im Norden zusammengebrochen. Mir wurde bei diesem Anblick bewusst, wie abhängig wir von den Verkehrsmitteln und insbesondere von Elektrizität waren. Gut, dass ich die Öfen im Cranzer Haus auf kleiner Flamme hatte brennen lassen. Wir würden wohl etwas länger hier verweilen müssen und hätten bei der Rückkehr ein völlig ausgekühltes Haus gehabt.
Die Nacht wurde mit einem herrlichen Abendfick im elterlichen Ehebett eingeleitet. Ich registrierte dabei, warum es ausgesprochen vorteilhaft war, einen großen Spiegel im Schlafzimmer zu haben.
Bitte E-Book-Format wählen:
Leben ist ein Nebenjob
Ein Roman von Uwe Prink
 XinXii, verschiedene Formate
XinXii, verschiedene Formate
 iBookstore
iBookstore
Roman
426 Seiten
ISBN: 978-3-9502871-2
 |
| Leben ist ein Nebenjob |
Leseprobe
Kapitel 33
Schneekatastrophe
So weit die Füße tragen
Cindy kam jetzt mit dem Firmenwagen nach Hause. Unser Audi hatte ja beim Unfall einen Totalschaden erlitten. Nachmittags begann es zu schneien und wir freuten uns über den Schnee. Wir kochten uns heißen Punsch und fühlten uns ganz wohl in unserem kleinen Haus, in dem die Öfen ordentlich gefüttert wurden und behagliche Wärme ausstrahlten.
In der Nacht wurden wir durch Sirenengeheul geweckt, das sehr nah zu sein schien. »Das ist doch bei uns vor der Tür«, sagte Cindy und ich stand auf, um aus dem Wohnzimmerfenster zu sehen. Schon in der Küche gewahrte ich einen hellen Lichtschein. Das schräg gegenüberliegende Gebäude, das eine Wurstfabrik beherbergte, brannte lichterloh. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr waren in klirrender Kälte bei der Arbeit. Glücklicherweise war das Haus zu weit entfernt, um uns zu gefährden. Nach einigen Stunden hatten sie das Feuer gelöscht und zogen wieder ab.
Am nächsten Morgen kam Cindy, die das Haus gerade auf dem Weg zur täglichen Fron verlassen hatte, überraschenderweise nach zwei Minuten wieder zurück. »Das musst du dir mal angucken.«
Der Creativshop-Wagen war direkt vor der Fleischfabrik geparkt und wies jetzt eine Eisschicht von circa fünfzehn Zentimeter Dicke auf. »Gefrorenes Löschwasser«, stellte ich fest, »den kannst du erst wieder benutzen, wenn es getaut hat.«
»Scheiße, jetzt muss ich mit dem Bus fahren. Wer weiß, wann ich dann in der Firma bin.«
»Ja und bei dem Schneetreiben fließt der Verkehr auch nicht wie sonst.«
»Heute muss ich unbedingt nach Hamburg, ich wollte doch noch bei meiner Mutter vorbei. Die jammert mir schon tagelang die Ohren voll, weil sie wieder Ärger mit ihrem österreichischen Seemann hat.« Es war gar nicht so selten, dass die Schluchtenscheißer sich für diesen Beruf entschieden.
»Der Arsch macht nur Mist und sie schickt ihn trotzdem nicht zum Teufel. Irgendwie hat sie auch selbst Schuld. Na ja, es ist halt meine Mutter.« Sie entschwand zur Bushaltestelle und ich betrachtete das immer stärker werdende Schneetreiben. Die Lage wurde dadurch noch verschärft, dass ein eisiger Wind blies, der dafür sorgte, dass sich der Schnee an manchen Stellen des Deiches türmte. Laufend fuhren Schneepflüge, um die Straßen befahrbar zu erhalten. Das sah mir verdächtig nach Sisyphusarbeit aus.
Ich kochte mir eine Kanne Tee, frühstückte und machte mich daran, den Weg zum Schuppen, in dem sich der Heizöltank für die Öfen befand, freizuschaufeln. Ein bisschen Spaß machte mir dieser Ausnahmezustand schon, denn er brachte Farbe in meinen Alltag. Als ich mächtig gegen das immer stärker werdende Schneetreiben angeschaufelt hatte, war das Gefühl beim Trinken einer heißen Hühnerbrühe wohliger als sonst und ich dachte: »Die hast du dir jetzt redlich verdient.« Wie köstlich konnte so eine Brühe doch munden, wenn man vorher geackert und gefroren hat.
Selbst am Tag war es draußen nicht richtig hell. Im Haus war es dadurch sehr düster. Gegen Abend überlegte ich mir, was ich für mich und meine Süße kochen sollte und wartete auf ihre Heimkehr. Dass sie eine Stunde überfällig war, war bei dem Wetter noch normal. Zwei Stunden später war sie immer noch nicht zu Hause. Jetzt fiel mir auch auf, dass schon seit Langem kein Bus mehr vorbei gefahren war. Zum ersten Mal bereute ich es, kein Radio zu haben. Ich wusste nicht, was Sache war. Wahrscheinlich war der Verkehr zusammengebrochen. Nichts fuhr mehr. Ich kombinierte, dass meine Kleine bei ihrer Mutter in Hamburg-Eimsbüttel geblieben war, und richtete mich auf eine einsame Nacht ein. Das nächste Telefon befand sich nicht weit vom Haus entfernt. Ich wollte zumindest wissen, dass bei Cindy alles im grünen Bereich war, und war zudem neugierig über ihren Kenntnisstand der Situation.
Ich stapfte durch den Schnee zum öffentlichen Fernsprecher. Durch den Wind war es saukalt. Ich warf das Geld ein und wartete. Nach kurzer Zeit war mein Engel schon am Telefon. Sie hatte schon auf meinen Anruf gewartet.
»Scheiße, ich komm’ hier nicht mehr weg«, sagte sie genervt, »und wenn das so weitergeht, dann morgen erst recht nicht.«
»Ist Charly da?«
»Nein, der hat wieder angeheuert und meine Mutter überlegt jetzt, ob sie ihn endgültig in die Pampa schickt. Sie hat die Nase voll von dem Suffkopp.«
»Na ja«, wollte ich mich selbst beruhigen, »solange noch ein paar Lebensmittel und Wein da sind, werd’ ich’s überleben ohne dich. Aber Sehnsucht habe ich jetzt schon.«
»Ich auch, mein Schatz. Es ist höhere Gewalt. Vielleicht möchte das Schicksal uns mal zeigen, wie es ist, wieder allein zu sein.«
»So als kleine Warnung, wenn wir uns streiten und ich mir denke, was soll ich eigentlich bei der dusseligen Kuh. Also, lass dich nicht von deiner Mutter nerven und sei froh, dass Charly nicht da ist.«
»Ja, Schatz, ruf morgen wieder an.«
»Mach’ ich, tschüs.«
»Tschüs.« Ich legte auf und trollte mich. Erst einmal einen Punsch und was zu essen war jetzt die Devise. Als ich satt war und der Alkohol ins Blut stieg, ging es wieder los. Dieses Mal konnte ich mir das gut erklären, denn ich fühlte mich unendlich allein und ausgeliefert. Erklärung hin, Erklärung her, die Nacht war furchtbar. Ich versuchte bei Licht zu schlafen, weil ich dachte, dass mich im Dunkeln die Dämonen abholen. Mit rationalen Gedanken war dem nicht beizukommen. Die Angst und das Unbehagen waren schlimmer.
Am nächsten Morgen öffnete ich die Haustür und sah statt der Straße nur weiß. Und was ich sah, war keine weiße Straße, sondern eine weiße Wand. Der Schnee hatte sich bis zur Dachrinne aufgetürmt.
Mit einem »Ach du Scheiße«, stürzte ich zur Hintertür, die zum Garten und zum Schuppen führte. Hier war es möglich, hinauszugelangen und wieder einen Weg zum Schuppen zu bahnen. In weiser Voraussicht hatte ich Schaufel und Schneeschieber gleich neben der Tür zum Garten deponiert. Den Weg zum Schuppen freizuschaufeln war ein schlimmes Geacker. Ich füllte die Tanks der Ölöfen vorsichtshalber randvoll. Beim Frühstück dachte ich mir, noch so eine Nacht muss ich nicht noch einmal haben. Aber das Chaos war perfekt. Wie sollte ich hier wegkommen? Fuhren in Hamburg überhaupt Bahnen und Busse? Und wenn ja, dann ab wo? Mit der Bahn konnte ich erst ab Altona wieder weiter fahren. Ich musste also zwangsläufig den Bus nehmen. Der Gedanke, hier wegzukommen, schmolz dahin. Die Straßen waren bei diesem Chaos am schwierigsten frei zu halten. Ich musste erst wieder telefonieren.
Cindy konnte Nachrichten hören und fernsehen. Ich erfuhr von ihr, dass Panzer eingesetzt würden, um die Straßen wieder befahrbar zu machen. Die Busse würden teilweise fahren, aber in Richtung Altona erst ab der Ortsmitte von Finkenwerder. Ich schluckte und sagte ihr, ich würde es trotzdem versuchen. Mein Vorhaben bedeutete, dass ich mich circa fünfzehn Kilometer durch den Schnee kämpfen musste. Ich wusste aber nicht, was mich am Elbdeich erwartete, wo das Land offen war. Der Schneesturm wurde hier nicht durch Bebauung abgemildert. Im Frühling hätte ich über diese Entfernung gelacht und mich sicher sofort auf den Weg gemacht. Bei diesem Unwetter musste man sich schon besser vorbereiten. Auf der anderen Seite wollte ich auf keinen Fall noch eine Nacht allein verbringen und außerdem war die Sache auch eine Herausforderung.
Ich erinnerte mich an Fernsehreportagen, die sich mit Polarforscher- oder Bergsteigerthemen befassten und wusste, dass ein Mensch in der Kälte viel Energie verliert. Also packte ich mir viel Schokolade und Kekse ein. Cindy hatte sich einen kleinen Schokovorrat angelegt, den ich jetzt plünderte. Dann kochte ich eine Kanne Tee und goss sie in die Thermosflasche. Von der Bundeswehr besaß ich noch lange, olivfarbene Unterhosen, und den Parka hatte man nach der Wehrdienstzeit auch behalten dürfen. Im Nachhinein war die Truppe doch noch zu etwas gut. So ausstaffiert und mit dicken Socken und Winterstiefeln machte ich mich auf in die Kälte.
Oben auf dem Deich, im Schutz der Häuser, konnte man ganz gut gehen. Vereinzelt versuchten Leute, ihre verschneiten Einfahrten freizuschaufeln. Ein älterer Mann, den ich nur vom Sehen kannte, fragte mich: »Wo wiss du denn hin, mien Jung?«
»Ich geh nach Hamburg.« So ein erstauntes Gesicht hatte ich schon lang nicht mehr gesehen.
Jemand fragte mich, ob ich zum Krämer wolle, der hätte nicht mehr viel zu bieten und ob ich etwas bräuchte. Die Menschen waren plötzlich wie ausgewechselt. Es herrschte eine Atmosphäre von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Warum braucht ihr erst eine Katastrophe, um das Maul aufzukriegen? Wäre doch nett, wenn es immer so wäre, dass man sich um den anderen kümmert. Ich lehnte mich gegen den Wind und ging weiter. Kurz vor dem Ortsausgang nahm ich einen kräftigen Schluck Tee und aß einen Riegel Schokolade. So, Junge, nu’ wird’s heftig.
An der Elbe machte ich Bekanntschaft mit Sankt Püsterich. Die einzige Möglichkeit durch zu kommen war, sich auf dem Deich zu bewegen. Die Verwehungen hatten die Straße bis auf halbe Deichhöhe geschluckt. Ab und zu schaute ein Autodach aus dem Schnee heraus. Panzer mit Schneeschiebern kamen mir entgegen. Wer sein Auto nicht akkurat am Straßenrand abgestellt hatte, musste damit rechnen, eine beschädigte Karre vorzufinden. Hier oben zu gehen, glich dem Waten durch brusthohes Wasser. Es stürmte heroben heftig, aber es war wie gesagt die einzige Möglichkeit vorwärts zu kommen. Unten war Tiefschnee, man wäre vollkommen darin versunken und möglicherweise von Panzerketten erfasst worden.
Ich musste an die Expedition von Amundsen und Scott denken und kam mir dabei lächerlich vor. Du gehst hier durch zivilisiertes Gebiet und die Jungs waren buchstäblich am Arsch der Welt. Völlig auf sich allein gestellt. Was für Helden. Was für ein Kraftakt. Aber was hatte sie angetrieben, so etwas zu tun? Die Gier nach Ruhm oder die Neugier des Entdeckers? War es die Herausforderung gewesen, die Natur zu besiegen? Was für ein Irrsinn war dieser Gedanke im Angesicht der begrenzten menschlichen Möglichkeiten. Scott hatte die Arschkarte gezogen, weil er glaubte, mit Pferden durchzukommen. Amundsen hatte ganz klar auf Hundeschlitten und Ski gesetzt. Seine Herkunft und seine Erfahrungen waren ihm hierbei von Vorteil gewesen.
Ich teilte meine Wanderung in Etappen ein. Erste Etappe: bis zum Ortsausgang Cranz. Die hatte ich genommen und befand mich jetzt auf der Geraden bis zur ersten Kurve.
Lange Geraden haben die schlechte Angewohnheit, unendlich zu erscheinen. Mein Ziel rückte zu langsam näher. Das Dunkelgrau des Himmels vereinigte sich mit dem grauen Wasser der Elbe zu einer konturlosen, übergangsfreien Masse.
Der Rotz aus meiner Nase floss auf meinen Schnurrdiburr, den ich über der Oberlippe trug. Erinnerungen an die Kindheit wurden wach, als ich den sogenannten »Schnodder« einfach wegleckte. Das ging doch ganz gut. Man ersparte es sich, die Handschuhe auszuziehen und kriegte keine kalten Hände.
Die zweite Etappe ließ ich hinter mich und bog auf die lange, schnurgerade Strecke zum Ortseingang von Finkenwerder ein.
Was musste der Alte in Russland erlebt haben! Wenn er sein Rendezvous mit Väterchen Frost nicht abgebrochen hätte, als er im Schnee gelegen hatte, verwundet durch einen Granatsplitter im Handgelenk, wäre ich heute nicht hier.
Er hatte mir erzählt, dass er damals immer müder geworden und schon über die Frierphase hinweg gewesen war. Es hatte ihm schon nichts mehr wehgetan. Aber der Wille zum Überleben hatte ihm geholfen, sich weiter zu schleppen, bis er bei seinen Kameraden war. Bei der Aktion hatte er seine Hand verloren. Sie war nicht mehr zu retten gewesen und musste amputiert werden.
Meine Sorgen wirkten bei diesen Gedanken geradezu winzig. Wir Kinder des Wirtschaftswunders waren doch im Vergleich zu diesen Menschen Weicheier.
Stapf, stapf, stapf. Schritte zu zählen, war langweilig.
»Geh meditativ«, sagte meine innere Stimme. Ich hielt nur kurze Zeit durch, dann kamen die Gedanken wieder zurück. Vielleicht klappte es mit einem Mantra.
»Om-go, om-go, om-go«, das lullte einigermaßen ein. Um nicht zu viel Energie zu verschwenden, flüsterte ich es leise vor mich hin. So hatte ich die dritte Etappe genommen.
Der Ortseingang von Finkenwerder beendete meine Meditation. So, mein Kleiner, jetzt noch einmal alles geben. Warum müssen diese verfluchten Dörfer bloß so elend lang sein? Bis zum Ortskern waren es noch einige Kilometer.
Die nächste Assoziation in meinem kalten Schädel befasste sich mit einem der Straßenfeger des 60er-Jahre-Fernsehens. Der Film bestand aus mehreren Teilen und handelte von der Flucht eines deutschen Soldaten aus der russischen Gefangenschaft. Der Titel war ›Soweit die Füße tragen‹. Bei jeder Folge dieses Streifens waren die Straßen leer gefegt wie bei der WM. Ich versuchte mir zum Zeitvertreib die Handlung ins Gedächtnis zu rufen, was mir aber nur weniger gut gelang.
Wie glücklich mussten die Bewohner von Finkenwerder, die an der Hauptstraße wohnen, doch in diesen Tagen sein. Kein Lärm, kein Gestank durch Autoverkehr. Diese Straße war sonst so stark frequentiert wie die B 73, eine der meistbefahrenen Bundesstraßen Deutschlands. Lebensqualität konnte ich mir hier unter normalen Umständen nicht vorstellen. Ich wünschte den Anwohnern noch viele ruhige Tage.
Der Ortskern rückte langsam aber sicher näher. In einigen Hundert Metern Entfernung meinte ich, eine Menschentraube zu sehen. Als ich näher kam, gerann mein Wunsch, der Vater dieses Gedankens, zur Realität. Die Leute warteten auf einen Bus. Hoffentlich kam zuerst der 150er nach Altona.
Die Wartenden waren in Gespräche vertieft und lachten. Jeder hatte etwas zu erzählen, ich sah freundliche Gesichter. Auf mich machte das den Eindruck, als wäre ich in einem südlichen Land.
Im Bus ging es genauso zu. Was war mit den Menschen passiert? Ich war immer kommunikativ im Bus. Manchmal wurde ich wie ein Alien angeguckt, weil ich wildfremden Leuten etwas zu sagen hatte. Besonders die Männer reagierten erstaunt und maulfaul. Möglicherweise fragten sie sich: »Ist der schwul?«
Jetzt redeten sie alle. Und ihre Gesichter bewegten sich sogar. Sonst waren Mimik und Gestik rar. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Mitreisenden würden unter peripherer Fazialislähmung leiden. Da waren nur versteinerte, traurige Gesichter der Menschen, die unter dem täglichen Trott litten, sich aber scheinbar damit abgefunden hatten. Unbeseelte Hüllen auf dem täglichen Gang nach Canossa, die sich jeden Tag erniedrigten in einer entfremdenden Tätigkeit. Buckelnd vor den Bossen. Erfüllungsgehilfen für eine glücklichere Welt, an der sie nie teilhaben werden. Doch sie bekamen diese bessere Welt jeden Tag im Fernsehen vorgesetzt.
Der einzige, unwahrscheinlichste Weg, der Fron zu entfliehen und auch in der Welt der Schönen und Reichen leben zu können, war der Lottoschein, den ich immer den »proletarischen Strohhalm« nannte. Leise sang Springsteen in meinem Kopf.
»Early in the morning, factory whistle blows,
man rises from bed and puts on his clothes …«
Jetzt, da ich die fröhlichen Menschen sah, wurde mir bewusst, dass auch ich so versteinert werden könnte und beschloss, diesem grauenhaften Trott soweit wie möglich zu entgehen.
Altonaer Bahnhof. Die Bahnen fuhren. Nach einiger Zeit tauchte ich an der Osterstraße aus dem Untergrund auf und ging die letzten Schritte zum Hellkamp, so hieß die Straße, in der meine zukünftige Schwiegermutter wohnte. Ich bedankte mich bei irgendeiner höheren Macht und drückte auf den Klingelknopf. Selten war ich so froh, meine Liebste zu sehen und sogar meine Schwiegermutter. Wer kann das schon von sich behaupten.
Im Folgenden bekam ich Vollversorgung: Heiße Suppe, Rumgrog und einen Platz zum Liegen auf dem Sofa inklusive einer wärmenden Decke. Es durchfloss mich ein heißes Glücksgefühl, das aufgrund seiner Intensität kaum zu ertragen war. War das schön.
Im Fernsehen verfolgte ich das ganze Ausmaß der Katastrophe. Dörfer waren eingeschneit, es gab Stromausfälle und außerhalb der Metropolen war der Verkehr im Norden zusammengebrochen. Mir wurde bei diesem Anblick bewusst, wie abhängig wir von den Verkehrsmitteln und insbesondere von Elektrizität waren. Gut, dass ich die Öfen im Cranzer Haus auf kleiner Flamme hatte brennen lassen. Wir würden wohl etwas länger hier verweilen müssen und hätten bei der Rückkehr ein völlig ausgekühltes Haus gehabt.
Die Nacht wurde mit einem herrlichen Abendfick im elterlichen Ehebett eingeleitet. Ich registrierte dabei, warum es ausgesprochen vorteilhaft war, einen großen Spiegel im Schlafzimmer zu haben.
Bitte E-Book-Format wählen:
Leben ist ein Nebenjob
Ein Roman von Uwe Prink
Montag, 20. Dezember 2010
Weihnachten in der Leseprobe – Wurzeln der Hoffnung
Wurzeln der Hoffnung von Miluna Tuani
Leseprobe
Doch nun galt es wieder einmal, den Fluss zu durchqueren. Sie tastete sich Schritt für Schritt voran durch das schlammig braune, reißende Wasser. Sie wusste, dass sie nicht hinfallen durfte. Dann würde ihr Weihnachtsmenü in den Fluten davonschwimmen.
Das Wasser schoss und wirbelte dahin und die Riemen des voll beladenen Rucksackes schnürten sie auf den Schultern ein. Sie war mehr als froh, als sie das andere Ufer endlich erreicht hatte. Bis zum Bauchnabel durchnässt aber ohne Verluste kletterte sie auf allen Vieren an der Uferböschung hoch. Sie rappelte sich auf und lief über den steinigen Weg zwischen den beiden Flussarmen.
Der zweite Flussarm war nur ein Rinnsal. Er führte nur dann nennenswert viel Wasser, wenn es mehrere Tage lang viel geregnet hatte.
Das Schlimmste des Weges hatte sie überwunden. Nun brauchte sie nur noch den steil ansteigenden aber verhältnismäßig gut begehbaren Weg bis zum Haus hoch zu laufen. Aber sie spürte schon Ermüdungserscheinungen. Der Rücken schmerzte unter dem Gewicht des Rucksacks und die Kleidung klebte kalt und feucht an ihrer Haut.
Erleichtert atmete sie aus, als sie das erste Tor erreicht hatte, dessen Pylone sie selbst aus den Steinen, die überall herumlagen, errichtet hatte. Nachdem sie es passiert hatte, kam schon das zweite Tor in Sicht, auch ein Produkt eines Anfalls von überflüssiger Energie, den sie ab und zu hatte.
Dahinter schaute das Häuschen hervor. Es war immer noch dicht bewachsen mit Efeuranken, die nun in voller Blüte standen. Alicia liebte den süßen, fruchtigen und betörenden Duft, der von ihnen ausging und ebenso den Duft der Blüten der alten Mimosenbäume. Sie schloss die Augen und atmete diese Wohlgerüche zufrieden ein.
Was für ein zauberhafter Ort das hier doch ist. Selbst im Dunkeln und mit geschlossenen Augen finde ich hierher zurück. Welch berauschender, süßer Duft. – Ich werde mich informieren, wie man Parfum herstellt, und ein Parfum aus diesen Wohlgerüchen kreieren. Ich bin sicher, das würde sich gut absetzen.
Alicia wurde in ihren Gedankengängen unterbrochen, als Shakira und ihre sieben Kinder, die inzwischen schon um einiges größer waren als ihre Mutter, freudig bellend angelaufen kamen. Sie begrüßten ihr Frauchen wie immer etwas zu stürmisch.
Alissaya, die rotbraune, sanfte Stute, die Lucrezia ihr zum Reiten und zum Transportieren von Sachen zur Verfügung gestellt hatte, kam ebenfalls auf sie zu. Die rotfellige Pferdedame hatte jedoch seit der Flutkatastrophe Angst vor dem lauten Fluss. Sie weigerte sich, ihn zu überqueren. So musste Alicia ihr Gepäck alleine schleppen.
Alicia streckte ihr die Hand entgegen und schrie die Hunde an: »Zitti, zitti [Kinder, Kinder], nicht anspringen, bitte! Sonst falle ich mit dem schweren Zeug wie eine Schildkröte auf den Rücken und komme nicht mehr hoch. Und wer hilft mir dann – keiner. Nein, so möchte ich nicht enden, und schon gar nicht zu Weihnachten.«
Sie schwankte die letzten Schritte bis zur hohen Steintreppe. Dann kniete sie sich erschöpft nieder und befreite sich von ihrer schweren Last. Die schmalen Riemen des Rucksacks hatten tiefe Einschnitte auf ihren Schultern hinterlassen, die sie sich nun massierte.
Andromeda und Xandulian, Lanni und Savi, die Lieblingskatzen, kamen angesprungen und die Hunde rannten ihnen hinterher.
»Zitti, jagt mir die Katzen nicht!«, rief sie energisch. Denn ihre laute, energische Stimme war das Einzige, worauf diese Hundekinder reagierten. Die Mischlinge aus Jagdhund und Belgischem Schäferhund verhielten sich abwechselnd wie schwer erziehbare Jagdhunde und wachsame Schäferhunde. Aber Alicia liebte die Hunde alle. Deshalb hatte sie es auch noch nicht übers Herz gebracht, einen Einzigen von ihnen abzugeben.
Andromeda und Xandu, die Stammeltern der Katzenzucht, sprangen auf Alicias Schulter. Sie stand nun auf, um die Tür aufzuschließen. Dabei rief sie den Hunden zu: »Ihr bleibt noch draußen! Ich muss erst alles vorbereiten. Dann gibt es Bescherung.«
Bitte E-Book-Format wählen:
Wurzeln der Hoffnung
Ein Roman von Miluna Tuani
 XinXii, verschiedene Formate
XinXii, verschiedene Formate
 iBookstore
iBookstore
Leseprobe
 |
| Wurzeln der Hoffnung |
Das Wasser schoss und wirbelte dahin und die Riemen des voll beladenen Rucksackes schnürten sie auf den Schultern ein. Sie war mehr als froh, als sie das andere Ufer endlich erreicht hatte. Bis zum Bauchnabel durchnässt aber ohne Verluste kletterte sie auf allen Vieren an der Uferböschung hoch. Sie rappelte sich auf und lief über den steinigen Weg zwischen den beiden Flussarmen.
Der zweite Flussarm war nur ein Rinnsal. Er führte nur dann nennenswert viel Wasser, wenn es mehrere Tage lang viel geregnet hatte.
Das Schlimmste des Weges hatte sie überwunden. Nun brauchte sie nur noch den steil ansteigenden aber verhältnismäßig gut begehbaren Weg bis zum Haus hoch zu laufen. Aber sie spürte schon Ermüdungserscheinungen. Der Rücken schmerzte unter dem Gewicht des Rucksacks und die Kleidung klebte kalt und feucht an ihrer Haut.
Erleichtert atmete sie aus, als sie das erste Tor erreicht hatte, dessen Pylone sie selbst aus den Steinen, die überall herumlagen, errichtet hatte. Nachdem sie es passiert hatte, kam schon das zweite Tor in Sicht, auch ein Produkt eines Anfalls von überflüssiger Energie, den sie ab und zu hatte.
Dahinter schaute das Häuschen hervor. Es war immer noch dicht bewachsen mit Efeuranken, die nun in voller Blüte standen. Alicia liebte den süßen, fruchtigen und betörenden Duft, der von ihnen ausging und ebenso den Duft der Blüten der alten Mimosenbäume. Sie schloss die Augen und atmete diese Wohlgerüche zufrieden ein.
Was für ein zauberhafter Ort das hier doch ist. Selbst im Dunkeln und mit geschlossenen Augen finde ich hierher zurück. Welch berauschender, süßer Duft. – Ich werde mich informieren, wie man Parfum herstellt, und ein Parfum aus diesen Wohlgerüchen kreieren. Ich bin sicher, das würde sich gut absetzen.
Alicia wurde in ihren Gedankengängen unterbrochen, als Shakira und ihre sieben Kinder, die inzwischen schon um einiges größer waren als ihre Mutter, freudig bellend angelaufen kamen. Sie begrüßten ihr Frauchen wie immer etwas zu stürmisch.
Alissaya, die rotbraune, sanfte Stute, die Lucrezia ihr zum Reiten und zum Transportieren von Sachen zur Verfügung gestellt hatte, kam ebenfalls auf sie zu. Die rotfellige Pferdedame hatte jedoch seit der Flutkatastrophe Angst vor dem lauten Fluss. Sie weigerte sich, ihn zu überqueren. So musste Alicia ihr Gepäck alleine schleppen.
Alicia streckte ihr die Hand entgegen und schrie die Hunde an: »Zitti, zitti [Kinder, Kinder], nicht anspringen, bitte! Sonst falle ich mit dem schweren Zeug wie eine Schildkröte auf den Rücken und komme nicht mehr hoch. Und wer hilft mir dann – keiner. Nein, so möchte ich nicht enden, und schon gar nicht zu Weihnachten.«
Sie schwankte die letzten Schritte bis zur hohen Steintreppe. Dann kniete sie sich erschöpft nieder und befreite sich von ihrer schweren Last. Die schmalen Riemen des Rucksacks hatten tiefe Einschnitte auf ihren Schultern hinterlassen, die sie sich nun massierte.
Andromeda und Xandulian, Lanni und Savi, die Lieblingskatzen, kamen angesprungen und die Hunde rannten ihnen hinterher.
»Zitti, jagt mir die Katzen nicht!«, rief sie energisch. Denn ihre laute, energische Stimme war das Einzige, worauf diese Hundekinder reagierten. Die Mischlinge aus Jagdhund und Belgischem Schäferhund verhielten sich abwechselnd wie schwer erziehbare Jagdhunde und wachsame Schäferhunde. Aber Alicia liebte die Hunde alle. Deshalb hatte sie es auch noch nicht übers Herz gebracht, einen Einzigen von ihnen abzugeben.
Andromeda und Xandu, die Stammeltern der Katzenzucht, sprangen auf Alicias Schulter. Sie stand nun auf, um die Tür aufzuschließen. Dabei rief sie den Hunden zu: »Ihr bleibt noch draußen! Ich muss erst alles vorbereiten. Dann gibt es Bescherung.«
Bitte E-Book-Format wählen:
Wurzeln der Hoffnung
Ein Roman von Miluna Tuani
Weihnachten in der Leseprobe – Olivers Reisen
Olivers Reisen von Sigrid Lenz
Leseprobe
Oliver schlenderte an Babettes Café vorbei und bemühte sich, einen möglich desinteressierten Eindruck zu hinterlassen. Lediglich aus den Augenwinkeln kontrollierte er, ob Susi zu sehen war. Als seine Suche keinen Erfolg zeigte, straffte er die Schultern und steuerte aus dem Städtchen heraus. Nicht, dass es schwierig war, den Ort zu verlassen. Egal, in welche Richtung er sich aufmachte, es dauerte nicht lange und er stand im freien Feld, im Wald oder unwegsamen Gelände. Die Gegend war so uninteressant wie ein Ballen Stroh.
Doch einen Ort gab es, an den Oliver sich hin und wieder gerne zurückzog. Sogar als die Temperaturen zu unwirtlich für längere Aufenthalte im Freien geworden waren.
Er setzte sich dort auf einen liegenden Baumstamm und zog seine Jacke fester um sich. Dann langte er nach einer Zigarette und zündete sie an.
Die Wolke gefrorenen Atems vermischte sich mit dem sich kräuselnden Rauch. Lange hielt er es in diesem Kaff nicht mehr aus – soviel war sicher.
Als er wider Erwarten Gesellschaft bekam, erstarrte er. Auf dem Weg tauchte eine Gestalt auf, die ihm vage bekannt vorkam. War es nicht der Mann, den er in der Nähe von Wolfgangs Haus gesehen hatte?
Oliver nahm einen Zug, hob sein Kinn, inhalierte, und stieß den Qualm dann herausfordernd aus.
Unter halb geschlossenen Lidern fixierte er den Fremden, der mit Entschiedenheit in seine Richtung steuerte. Er besaß ausreichend Erfahrung mit schamlosen Freiern, die dachten, sie könnten sich an jeden Jungen heranmachen, egal welchen Alters. Nur war ihm dieser Typ Mann in der Kleinstadt bislang nicht begegnet. Andererseits sah der Fremde ganz so aus, als befände er sich auf der Durchreise.
Oliver musterte ihn. Nicht dass er große Lust auf eine Auseinandersetzung verspürte, aber in seiner momentanen Stimmung hatte er auch nicht vor, einer solchen aus dem Weg zu gehen.
Der Mann blieb vor ihm stehen.
Sollte er sich ruhig trauen, noch näher zu kommen, dann würde er ihm schon zeigen, wo es lang ging. Doch der andere kam nicht näher.
Er blieb stehen und fischte seinerseits eine Packung Zigaretten aus der Tasche. »Bist du nicht zu jung zum Rauchen?«, gestikulierte er mit einer Zigarette in der Hand.
Oliver schüttelte den Kopf.
Der andere schwieg, und starrte ihn weiterhin an.
»So einer bin ich nicht«, knurrte Oliver schließlich abweisend.
»Was für einer?«, fragte der andere entgeistert.
»Na – so einer.« Oliver ließ seinen Blick auffallend langsam in Richtung von Massimos Unterleib gleiten.
»He! Fiele mir im Traum nicht ein.«
»Dann ist ja gut.«
Oliver wandte seinen Blick ab. Er betrachte das klägliche Rinnsal vor seinen Füßen. Nur wenig kälter und der Bach wäre gefroren. In wenigen Wochen war Oliver gezwungen, mit Wolfgang Weihnachten zu feiern. Er rollte mit den Augen. Im Winter abzuhauen schien zwar reichlich dämlich und sein einziger Versuch, Agnes per Telefon aufzuspüren, hatte zu nichts geführt. Dennoch fürchtete er, dass ihm der Feiertagskram in dieser Stadt noch mehr auf die Nerven gehen würde als irgendwo anders. Wenn er Pech hatte, verlangte Wolfgang noch von ihm, in die Kirche zu gehen.
Olivers Blick streifte wieder Massimo, der immer noch vor ihm stand, an seiner Zigarette zog und ihn prüfend betrachtete.
»Hast du ein Problem? Ich kam hierher, um allein zu sein. Normalerweise leistet mir an diesem spannenden Ort niemand Gesellschaft. Und jetzt brauche ich das schon gar nicht.«
Massimo schüttelte den Kopf: »Ist schon gut. Ich kenn dich von früher.«
»Was?« Für eine Sekunde sah Oliver den Mann aufmerksam an. »Da klickt nichts bei mir.«
»Ist ein Weilchen her.«
»Aha.«
»Ich konnte deine Mutter nicht auftreiben.«
»Wie aufregend.«
»Na ja. Dann geh ich mal.«
Massimo ließ die Zigarette zu Boden fallen und trat sie aus.
Oliver hob kurz den Blick, wandte diesen jedoch rasch wieder ab und lauschte, wie sich die Schritte von ihm entfernten. Der Boden knirschte leise unter Massimos Schuhen.
Bitte E-Book-Format wählen:
Olivers Reisen
Ein Roman von Sigrid Lenz
 XinXii, verschiedene
Formate
XinXii, verschiedene
Formate
 iBookstore
iBookstore
Leseprobe
 |
| Olivers Reisen |
Doch einen Ort gab es, an den Oliver sich hin und wieder gerne zurückzog. Sogar als die Temperaturen zu unwirtlich für längere Aufenthalte im Freien geworden waren.
Er setzte sich dort auf einen liegenden Baumstamm und zog seine Jacke fester um sich. Dann langte er nach einer Zigarette und zündete sie an.
Die Wolke gefrorenen Atems vermischte sich mit dem sich kräuselnden Rauch. Lange hielt er es in diesem Kaff nicht mehr aus – soviel war sicher.
Als er wider Erwarten Gesellschaft bekam, erstarrte er. Auf dem Weg tauchte eine Gestalt auf, die ihm vage bekannt vorkam. War es nicht der Mann, den er in der Nähe von Wolfgangs Haus gesehen hatte?
Oliver nahm einen Zug, hob sein Kinn, inhalierte, und stieß den Qualm dann herausfordernd aus.
Unter halb geschlossenen Lidern fixierte er den Fremden, der mit Entschiedenheit in seine Richtung steuerte. Er besaß ausreichend Erfahrung mit schamlosen Freiern, die dachten, sie könnten sich an jeden Jungen heranmachen, egal welchen Alters. Nur war ihm dieser Typ Mann in der Kleinstadt bislang nicht begegnet. Andererseits sah der Fremde ganz so aus, als befände er sich auf der Durchreise.
Oliver musterte ihn. Nicht dass er große Lust auf eine Auseinandersetzung verspürte, aber in seiner momentanen Stimmung hatte er auch nicht vor, einer solchen aus dem Weg zu gehen.
Der Mann blieb vor ihm stehen.
Sollte er sich ruhig trauen, noch näher zu kommen, dann würde er ihm schon zeigen, wo es lang ging. Doch der andere kam nicht näher.
Er blieb stehen und fischte seinerseits eine Packung Zigaretten aus der Tasche. »Bist du nicht zu jung zum Rauchen?«, gestikulierte er mit einer Zigarette in der Hand.
Oliver schüttelte den Kopf.
Der andere schwieg, und starrte ihn weiterhin an.
»So einer bin ich nicht«, knurrte Oliver schließlich abweisend.
»Was für einer?«, fragte der andere entgeistert.
»Na – so einer.« Oliver ließ seinen Blick auffallend langsam in Richtung von Massimos Unterleib gleiten.
»He! Fiele mir im Traum nicht ein.«
»Dann ist ja gut.«
Oliver wandte seinen Blick ab. Er betrachte das klägliche Rinnsal vor seinen Füßen. Nur wenig kälter und der Bach wäre gefroren. In wenigen Wochen war Oliver gezwungen, mit Wolfgang Weihnachten zu feiern. Er rollte mit den Augen. Im Winter abzuhauen schien zwar reichlich dämlich und sein einziger Versuch, Agnes per Telefon aufzuspüren, hatte zu nichts geführt. Dennoch fürchtete er, dass ihm der Feiertagskram in dieser Stadt noch mehr auf die Nerven gehen würde als irgendwo anders. Wenn er Pech hatte, verlangte Wolfgang noch von ihm, in die Kirche zu gehen.
Olivers Blick streifte wieder Massimo, der immer noch vor ihm stand, an seiner Zigarette zog und ihn prüfend betrachtete.
»Hast du ein Problem? Ich kam hierher, um allein zu sein. Normalerweise leistet mir an diesem spannenden Ort niemand Gesellschaft. Und jetzt brauche ich das schon gar nicht.«
Massimo schüttelte den Kopf: »Ist schon gut. Ich kenn dich von früher.«
»Was?« Für eine Sekunde sah Oliver den Mann aufmerksam an. »Da klickt nichts bei mir.«
»Ist ein Weilchen her.«
»Aha.«
»Ich konnte deine Mutter nicht auftreiben.«
»Wie aufregend.«
»Na ja. Dann geh ich mal.«
Massimo ließ die Zigarette zu Boden fallen und trat sie aus.
Oliver hob kurz den Blick, wandte diesen jedoch rasch wieder ab und lauschte, wie sich die Schritte von ihm entfernten. Der Boden knirschte leise unter Massimos Schuhen.
Bitte E-Book-Format wählen:
Olivers Reisen
Ein Roman von Sigrid Lenz
Weihnachten in der Leseprobe – Leben ist ein Nebenjob
Leben ist ein Nebenjob von Uwe Prink
Leseprobe
Ich war mit Judith zusammen. Judith war ein zartes, schlankes Mädchen mit jungenhaft schmalen Hüften und birnenförmigen, auffallenden Mopsbürschchen. Ihr Minirock war nicht mehr als ein breiter Gürtel. Alles sehr überzeugend. Rollos runter. Vorhänge zu. Draußen regnete es sowieso. Wie meistens. Das machte die Szenerie noch ein bisschen schummriger. Einer der Vorteile Norddeutschlands.
Jetzt durften die Hände schon mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Aber vorsichtig. Ich war ja so schüchtern. Pro viertel Stunde drei bis vier Zentimeter. Nur nichts falsch machen.
Was stand noch in der ›Bravo‹? Wo waren die erogenen Zonen? Ah ja, hinter den Ohren, am Hals. Die weiche Haut zwischen den Schenkeln. Scheiße – Strumpfhosen! Wie kam man da an die Schenkel? Mit den Fingern auf den Strumpfhosen war’s auch schon aufregend genug. Je höher, desto heißer.
Mittlerweile war eine Ewigkeit vergangen. Endlich das obere Ende der Strumpfhose. Scheißstrammes Gummi. Mit dem Slip zusammen Gummi in zweifacher Ausführung. Das war schwierig zu handhaben. Aber wenn man schon mal hier ist.
Langsam arbeitete sich meine Hand ins Paradies vor. Zentimeter für Zentimeter, mit langsam absterbendem Blutkreislauf krabbelte die Hand in Richtung Bermuda Dreieck. Das Handgelenk war schon fast taub.
Der Zehnerwechsler für die Singles machte noch brav seine Arbeit. »I ’m A Loser, I ’m A Loser. And I’m not what I appear to be …«
Wie sollte ich die Innenhaut der Schenkel zart streicheln, wenn die Hand von dieser elenden, strammen Kunstfaser platt gedrückt wird? Außerdem war die ganze Körperhaltung auf die Dauer ein totaler Krampf. Aber was tut man nicht alles für das Paradies. Die ganze Angelegenheit lief zudem schweigend ab.
Stilles Genießen oder Unsicherheit? Sei ein Mann und mach weiter. Die Schamhaare waren erreicht. Eine neue Attraktion unter den Fingern. Weibliche Schamhaare. Ganz schön hart, diese Haare. Jetzt aber weiter. Wie war das noch, Klitoris? Vielleicht sogar der Kitzler. Hihi. Leichtes Kreisen. Die Hand stirbt ab. Aber ich glaube, ihr gefällt’s. Findet sie mich jetzt gut, habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
Oswald Kolle: ›Das Wunder der Liebe‹. Soll ich den Finger reinstecken? Natürlich, wie sollst du denn sonst wissen, wie das ist. Dschungelfieber, weich, warm und feucht. Kosmisch. Tatsächlich, Oswald hatte nicht zu viel versprochen. Ich war am Ziel und es war aufregend. Seltsam allerdings, dass ich mich nicht an ihre Berührung erinnere?
So verbrachten wir viele schöne Nachmittage als Pioniere in unerforschten Gebieten. Aufregend war’s.
Mittlerweile hatte ich das Kellerzimmer von Wolf übernommen, weil der zu Tante Annemarie gezogen war. Warum? Keine Ahnung. Querelen mit dem Alten, diese familiäre Enge, ich weiß es nicht. Ich war jedenfalls glücklich. Konnte ich doch nun meine Pettingspiele in der eigenen Hütte veranstalten. Das gab natürlich Heimvorteil.
Ich war stolz auf die Tapeten. Mein Bruder Rolf nannte es »Moderne Kunst«. Verrückte abstrakte Muster.
Zu Weihnachten hatte ich einen Plattenspieler bekommen. Einen Musikus 105V von Telefunken. Ausgelegt für Stereo. Man brauchte bloß noch einen zweiten Verstärker für den anderen Kanal. Das alte Radio mit dem Holzchassis war dafür ideal. Mit einem Adapter für die Bananenstecker musste es klappen.
Die Bands wurden jetzt zahlreicher. The Kinks: ›Sunny Afternoon‹, ›You Really Got Me‹. The Troggs: ›Wild Thing‹. The Small Faces: ›Tin Soldier‹, intensives, absolutes Durchdrehen. Dieses ruhige Piano-Intro und dann treibendes Losheizen, diese Kraft, diese Energie, unglaublich. Überhaupt war alles englisch und »The«. Dann die Beachboys. »Bababa, bababaranne, babaraaanne ...« Amerikanisch und trotzdem gut, dachten wir. Mit ›Good Vibrations‹ spielten sie dann endgültig in der ersten Liga.
Wir veranstalteten des Öfteren private Hitparaden-Nachmittage. Da wurden Songs nach einem ausgeklügelten Beurteilungssystem bewertet. Der Gesang, die Komposition, das Arrangement, wilde Soli, die Message oder, was wir dafür hielten, wurden von uns mit Kennermienen einer strengen Prüfung unterzogen.
›My Generation‹ von The Who gegen ›Bus Stop‹ von The Hollies. Da ist die Fragestellung schon Makulatur. Natürlich überwogen wilde Soli und die Message bei den Who. Es wurde über die restlichen Kriterien noch gestritten, aber es gewannen die Who. Obwohl der mehrstimmige Gesang von den Hollies schon eine Klasse für sich war.
So verlebten wir die Tage im Rausch der Musik, wenn auch ab und zu Oma Prank in den Keller kam und zeterte: »Mog disse Negermusik mol lieser!« Sie war mehr in der Heideröslein-Ecke zuhause.
Oma Prank musste uns wieder »Flötentöne« beibringen, weil meine Mutter jetzt mitarbeitete, um das Haus nicht den »gierigen Hypothekengangstern« preiszugeben.
Mama trug ihre Haut am Fließband der Firma ›Elida Gibbs‹ zu Markte. Hersteller von Seifen, Deodorants und Kosmetikartikeln.
Der Zeitmangel, bedingt durch zwei voll berufstätige Elternteile, brachte Ödnis in den Speiseplan der Familie. Currywurst mit Spaghetti war angesagt. Nur wenn Oma mal kochte, gab es den besten Blumenkohl der Welt, in dessen weißer Soße sich reichlich dicke Spuren von guter Butter befanden. Sie kochte eben wie eine kleine, liebe Oma.
Bitte E-Book-Format wählen:
Leben ist ein Nebenjob
Ein Roman von Uwe Prink
 XinXii, verschiedene Formate
XinXii, verschiedene Formate
 iBookstore
iBookstore
Leseprobe
 |
| Leben ist ein Nebenjob |
Jetzt durften die Hände schon mal ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Aber vorsichtig. Ich war ja so schüchtern. Pro viertel Stunde drei bis vier Zentimeter. Nur nichts falsch machen.
Was stand noch in der ›Bravo‹? Wo waren die erogenen Zonen? Ah ja, hinter den Ohren, am Hals. Die weiche Haut zwischen den Schenkeln. Scheiße – Strumpfhosen! Wie kam man da an die Schenkel? Mit den Fingern auf den Strumpfhosen war’s auch schon aufregend genug. Je höher, desto heißer.
Mittlerweile war eine Ewigkeit vergangen. Endlich das obere Ende der Strumpfhose. Scheißstrammes Gummi. Mit dem Slip zusammen Gummi in zweifacher Ausführung. Das war schwierig zu handhaben. Aber wenn man schon mal hier ist.
Langsam arbeitete sich meine Hand ins Paradies vor. Zentimeter für Zentimeter, mit langsam absterbendem Blutkreislauf krabbelte die Hand in Richtung Bermuda Dreieck. Das Handgelenk war schon fast taub.
Der Zehnerwechsler für die Singles machte noch brav seine Arbeit. »I ’m A Loser, I ’m A Loser. And I’m not what I appear to be …«
Wie sollte ich die Innenhaut der Schenkel zart streicheln, wenn die Hand von dieser elenden, strammen Kunstfaser platt gedrückt wird? Außerdem war die ganze Körperhaltung auf die Dauer ein totaler Krampf. Aber was tut man nicht alles für das Paradies. Die ganze Angelegenheit lief zudem schweigend ab.
Stilles Genießen oder Unsicherheit? Sei ein Mann und mach weiter. Die Schamhaare waren erreicht. Eine neue Attraktion unter den Fingern. Weibliche Schamhaare. Ganz schön hart, diese Haare. Jetzt aber weiter. Wie war das noch, Klitoris? Vielleicht sogar der Kitzler. Hihi. Leichtes Kreisen. Die Hand stirbt ab. Aber ich glaube, ihr gefällt’s. Findet sie mich jetzt gut, habe ich meine Hausaufgaben gemacht.
Oswald Kolle: ›Das Wunder der Liebe‹. Soll ich den Finger reinstecken? Natürlich, wie sollst du denn sonst wissen, wie das ist. Dschungelfieber, weich, warm und feucht. Kosmisch. Tatsächlich, Oswald hatte nicht zu viel versprochen. Ich war am Ziel und es war aufregend. Seltsam allerdings, dass ich mich nicht an ihre Berührung erinnere?
So verbrachten wir viele schöne Nachmittage als Pioniere in unerforschten Gebieten. Aufregend war’s.
Mittlerweile hatte ich das Kellerzimmer von Wolf übernommen, weil der zu Tante Annemarie gezogen war. Warum? Keine Ahnung. Querelen mit dem Alten, diese familiäre Enge, ich weiß es nicht. Ich war jedenfalls glücklich. Konnte ich doch nun meine Pettingspiele in der eigenen Hütte veranstalten. Das gab natürlich Heimvorteil.
Ich war stolz auf die Tapeten. Mein Bruder Rolf nannte es »Moderne Kunst«. Verrückte abstrakte Muster.
Zu Weihnachten hatte ich einen Plattenspieler bekommen. Einen Musikus 105V von Telefunken. Ausgelegt für Stereo. Man brauchte bloß noch einen zweiten Verstärker für den anderen Kanal. Das alte Radio mit dem Holzchassis war dafür ideal. Mit einem Adapter für die Bananenstecker musste es klappen.
Die Bands wurden jetzt zahlreicher. The Kinks: ›Sunny Afternoon‹, ›You Really Got Me‹. The Troggs: ›Wild Thing‹. The Small Faces: ›Tin Soldier‹, intensives, absolutes Durchdrehen. Dieses ruhige Piano-Intro und dann treibendes Losheizen, diese Kraft, diese Energie, unglaublich. Überhaupt war alles englisch und »The«. Dann die Beachboys. »Bababa, bababaranne, babaraaanne ...« Amerikanisch und trotzdem gut, dachten wir. Mit ›Good Vibrations‹ spielten sie dann endgültig in der ersten Liga.
Wir veranstalteten des Öfteren private Hitparaden-Nachmittage. Da wurden Songs nach einem ausgeklügelten Beurteilungssystem bewertet. Der Gesang, die Komposition, das Arrangement, wilde Soli, die Message oder, was wir dafür hielten, wurden von uns mit Kennermienen einer strengen Prüfung unterzogen.
›My Generation‹ von The Who gegen ›Bus Stop‹ von The Hollies. Da ist die Fragestellung schon Makulatur. Natürlich überwogen wilde Soli und die Message bei den Who. Es wurde über die restlichen Kriterien noch gestritten, aber es gewannen die Who. Obwohl der mehrstimmige Gesang von den Hollies schon eine Klasse für sich war.
So verlebten wir die Tage im Rausch der Musik, wenn auch ab und zu Oma Prank in den Keller kam und zeterte: »Mog disse Negermusik mol lieser!« Sie war mehr in der Heideröslein-Ecke zuhause.
Oma Prank musste uns wieder »Flötentöne« beibringen, weil meine Mutter jetzt mitarbeitete, um das Haus nicht den »gierigen Hypothekengangstern« preiszugeben.
Mama trug ihre Haut am Fließband der Firma ›Elida Gibbs‹ zu Markte. Hersteller von Seifen, Deodorants und Kosmetikartikeln.
Der Zeitmangel, bedingt durch zwei voll berufstätige Elternteile, brachte Ödnis in den Speiseplan der Familie. Currywurst mit Spaghetti war angesagt. Nur wenn Oma mal kochte, gab es den besten Blumenkohl der Welt, in dessen weißer Soße sich reichlich dicke Spuren von guter Butter befanden. Sie kochte eben wie eine kleine, liebe Oma.
Bitte E-Book-Format wählen:
Leben ist ein Nebenjob
Ein Roman von Uwe Prink
Weihnachten in der Leseprobe – Nur geträumt?
Nur geträumt? Abschied von der großen Liebe von Christine Lackner
Leseprobe
Als wir mit einer größeren Gruppe von Absolventen des Kurses zu dem lange zuvor geplanten Skiwochenende aufbrachen, war ich aufgeregt wie als Kind zu Weihnachten, wenn die Anspannung und die Neugier auf den Lichterbaum und die Geschenke kaum noch zu ertragen waren.
Ich sollte bei ihm im Auto mitfahren, darum verabredeten wir uns vor seinem Haus. Dort traf ich zum ersten Mal auf seine kleine Tochter, die gerade im Garten spielte. Dem Mädchen war weder ein Lächeln zu entlocken, noch bekam ich auf gestellte Fragen Antworten. Sie maß mich lediglich mit durchdringenden Blicken aus zornigen Augen, die Ähnlichkeit mit jenen eines Erwachsenen hatten.
Philipps Frau lud mich völlig ungezwungen zu einem schnellen Essen in die neue Küche ein. Aber sosehr mir normalerweise Lasagne schmeckte, in diesem Moment konnte ich nicht mehr in meinem Mund fühlen als etwas zwischen den Zähnen, das ich auf schnellstem Wege mit Mineralwasser hinunterzuspülen versuchte. Mir saß ein dicker Kloß im Hals, als ich mitbekam, wie sehr sich seine Frau um ihn bemühte. Ihr Äußeres überraschte mich, die schönen langen Haare, der offene Blick, das freundliche Lachen. Sie war das genaue Gegenteil jener Person, die ich mir während der Gespräche mit Philipp zusammengereimt hatte.
Ich kam mir in jenem Moment total fehl am Platz vor, fühlte mich wie eine Diebin auf frischer Tat ertappt und hatte es eilig, dieser Situation und Philipps Zuhause den Rücken zu kehren.
Ein uraltes Bauernhaus auf einer schneebedeckten Lichtung, gesäumt von dichtem, dunklem Tannenwald, lud bereits aus der Ferne zum Träumen ein.
Nachdem die Kälte aus der Stube vertrieben war durch das Herdfeuer, das wohlige Wärme ausströmte, bezogen wir die Schlafräume. Die Aufteilung der Anwesenden auf die vorhandenen Betten gestaltete sich als gar nicht so einfach, sollten doch freundschaftliche Bande berücksichtigt werden.
Ich erhielt mit meiner Freundin ein Zimmer unter dem Dach mit einem großen Doppelbett. Weitere Frauen bezogen im ersten Stock Quartier. Im Erdgeschoss hinter der alten, urigen Stube fanden die Männer eine Schlafstätte, teilten sich zu dritt ein Ehebett und einer erkämpfte sich ein Einzelbett.
Die Männer kochten, die Frauen deckten den Tisch und erledigten den Abwasch.
Das Essen war ein Gedicht. Dafür ernteten die Männer reichlich Lob und Bewunderung. Wein, Bier und auch alkoholfreie Getränke flossen im Übermaß. Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen.
Ich schaltete ab und ging vollkommen in der positiven Atmosphäre auf.
Viele Themen wurden angeschnitten und scheinbar endlose Diskussionen ausgetragen. Kaffee und mitgebrachte, selbst gebackene Köstlichkeiten versüßten den anbrechenden Abend, Spiele und Glühwein taten das Übrige.
Ich tankte geistige Energie, indem ich mich jenen Menschen zuwandte, die mir, jeder für sich als einzigartiges Wesen aus Lebenserfahrung und Lebensfreude, Kraft schenkten.
Dennoch gingen mir die Gespräche mit Philipp am tiefsten. Vielleicht befanden wir uns gerade auf einer ähnlichen emotionalen Ebene.
Bei Musik mit zu Herzen gehenden Texten, sogenannten Zeitgeistliedern, gestattete ich mir für Momente Bilder, die allein Philipp und mich beinhalten. Ich wurde zum ruhenden, hinnehmenden Ufer, er zum streichelnden, wogenden Meer.
Einmal verschlingen wir uns zu einem großen Ganzen, werden von höheren Mächten auseinandergerissen, um anschließend nur noch viel aufgewühlter und stürmischer miteinander zu verschmelzen.
Es fiel mir nicht leicht, mich von den Phantasien loszureißen. Meine Augen durften nicht zu lange auf ihm ruhen. Seinen Blicken wich ich aus, so gut es ging. Wir waren schließlich verheiratet, hatten beide Kinder und eheliche Verpflichtungen. Als warnendes Signal rief ich mir immer wieder das Bild seiner Familie ins Gedächtnis, um ja nicht vom Pfad der Tugend abzukommen. Waren wir gar auf der Hütte schon reif, einander zum Opfer zu fallen?
Der Himmel hatte sein Sternenzelt ausgebreitet, als eine kleine Gruppe zum Rodeln aufbrach. Bereits nach wenigen Schritten fanden wir beide uns nebeneinander herwandernd, den Hügel erklimmend, wieder. Leider war der Schnee zu nass, so konnten wir nicht auf den mitgebrachten Kunststoffsäcken talwärts rutschen. Ein paar Leute gingen ins Haus zurück, die übrigen unternahmen einen Nachtspaziergang.
Die Schneedecke funkelte, der Mond leuchtete uns den Weg. Ich versprach Philipp Auszüge aus dem Konzept des Sozialprojektes, er wollte mir Musik und Literatur nahe bringen, die ihm besonders viel bedeutete.
Als wir zurückkehrten, ging es schon auf Mitternacht zu und einige tanzten noch ausgelassen zur Musik auf den Holztischen vor der Hütte. Wir setzten uns etwas abseits. Im Schutze der Dunkelheit sprach er dann von Gefühlen und Seelenqualen, die seinen Workaholismus betrafen, der angeblich sein familiäres Leben überschattete, im Besonderen aber seine persönliche Entwicklung stagnieren ließ. Ich hörte ihm aufmerksam zu, war zugleich innerlich aufgewühlt, ja regelrecht schockiert.
Im Bett war meine Müdigkeit wie verflogen. Ich lag noch lange Zeit mit offenen Augen neben der schlafenden Freundin. Unter lautem Getöse rutschte eine Dachlawine ab und nach höchstens zwei Stunden Schlaf stand Skifahren am Programm.
Ich hatte wohl meine physischen Kräfte überschätzt. Fast kein Schlaf, starker Kaffee, kein Bissen im Bauch, dazu kam der Höhenunterschied bei der Fahrt mit der Gondel zur Bergstation. Ich erlitt einen Kreislaufkollaps.
Schweißgebadet, mit zittrigen Beinen auf den Skiern ins Tal rutschend, von ein paar Leuten aus unserer Gruppe zur Absicherung im Konvoi begleitet, erreichte ich die Talstation. Nach einem doppelten Schnaps und einer heißen Suppe im Restaurant stabilisierte sich mein Kreislauf allmählich. Inzwischen tobte sich Philipp auf der Piste aus, die weiblichen Skifans forderten ihn heraus.
Den letzten Tag verbrachte jeder mit seinen Vorlieben. Einige lagen vor dem Haus in der Sonne, lasen, hörten Musik oder diskutierten über Liedertexte. Andere wanderten auf den Hausberg. Philipp verbrachte mit ein paar sportlichen Freaks nochmals einen halben Tag auf der Piste. Mit etwas Wehmut im Herzen reinigten wir gemeinsam Stube, Küche und Zimmer.
Gegen Abend, noch ehe der geschmolzene Schnee zu vereisen begann, brachen wir in einer Kolonne die Heimreise an.
Bereits am frühen Morgen hatte mich Pauls Anruf beunruhigt. Angeblich war unsere Tochter wieder einmal nicht nach Hause gekommen. Ich fuhr mit gemischten Gefühlen heimwärts, ahnte, dass der Anruf lediglich ein Vorbote zu einer längeren Auseinandersetzung gewesen war.
Philipp versuchte, mich abzulenken. Er versprach mir beizustehen, falls es größere Schwierigkeiten geben sollte. Seine Frau habe schließlich schon mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet, sie würde bestimmt auch mein Kind bei sich aufnehmen, und er wäre der Letzte, der etwas dagegen hätte.
Diese Aussichten machten mich zuversichtlicher und beruhigten mich während der langen Heimfahrt. Trotz aufheiternder Gespräche, die uns die Fahrt verkürzten, war ich angespannt. Schließlich stand unser ersehntes Fortgehen als krönender Abschluss des Skiwochenendes auf dem Spiel.
Unter dem Vorwand, gemeinsam nach der Tochter zu suchen, holte mich eine Freundin von Zuhause ab. Tanja war inzwischen zwar kurz da gewesen, jedoch gleich wieder verschwunden, als sie gemerkt hatte, dass ich noch abwesend war.
Nachdem wir sämtliche Innenstadtlokale vergebens nach ihr abgesucht hatten, gaben wir die Suche auf. Nicht der geringste Hinweis kam, wo Tanja stecken könnte, denn ihr neuer Freundeskreis hielt dicht.
Inzwischen wartete der harte Kern unserer Gruppe in einer Diskothek auf uns.
Bitte E-Book-Format wählen:
Nur geträumt?
Ein Roman von Christine Lackner
 XinXii, verschiedene
Formate
XinXii, verschiedene
Formate
 iBookstore
iBookstore
Leseprobe
 |
| Nur geträumt? |
Ich sollte bei ihm im Auto mitfahren, darum verabredeten wir uns vor seinem Haus. Dort traf ich zum ersten Mal auf seine kleine Tochter, die gerade im Garten spielte. Dem Mädchen war weder ein Lächeln zu entlocken, noch bekam ich auf gestellte Fragen Antworten. Sie maß mich lediglich mit durchdringenden Blicken aus zornigen Augen, die Ähnlichkeit mit jenen eines Erwachsenen hatten.
Philipps Frau lud mich völlig ungezwungen zu einem schnellen Essen in die neue Küche ein. Aber sosehr mir normalerweise Lasagne schmeckte, in diesem Moment konnte ich nicht mehr in meinem Mund fühlen als etwas zwischen den Zähnen, das ich auf schnellstem Wege mit Mineralwasser hinunterzuspülen versuchte. Mir saß ein dicker Kloß im Hals, als ich mitbekam, wie sehr sich seine Frau um ihn bemühte. Ihr Äußeres überraschte mich, die schönen langen Haare, der offene Blick, das freundliche Lachen. Sie war das genaue Gegenteil jener Person, die ich mir während der Gespräche mit Philipp zusammengereimt hatte.
Ich kam mir in jenem Moment total fehl am Platz vor, fühlte mich wie eine Diebin auf frischer Tat ertappt und hatte es eilig, dieser Situation und Philipps Zuhause den Rücken zu kehren.
Ein uraltes Bauernhaus auf einer schneebedeckten Lichtung, gesäumt von dichtem, dunklem Tannenwald, lud bereits aus der Ferne zum Träumen ein.
Nachdem die Kälte aus der Stube vertrieben war durch das Herdfeuer, das wohlige Wärme ausströmte, bezogen wir die Schlafräume. Die Aufteilung der Anwesenden auf die vorhandenen Betten gestaltete sich als gar nicht so einfach, sollten doch freundschaftliche Bande berücksichtigt werden.
Ich erhielt mit meiner Freundin ein Zimmer unter dem Dach mit einem großen Doppelbett. Weitere Frauen bezogen im ersten Stock Quartier. Im Erdgeschoss hinter der alten, urigen Stube fanden die Männer eine Schlafstätte, teilten sich zu dritt ein Ehebett und einer erkämpfte sich ein Einzelbett.
Die Männer kochten, die Frauen deckten den Tisch und erledigten den Abwasch.
Das Essen war ein Gedicht. Dafür ernteten die Männer reichlich Lob und Bewunderung. Wein, Bier und auch alkoholfreie Getränke flossen im Übermaß. Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen.
Ich schaltete ab und ging vollkommen in der positiven Atmosphäre auf.
Viele Themen wurden angeschnitten und scheinbar endlose Diskussionen ausgetragen. Kaffee und mitgebrachte, selbst gebackene Köstlichkeiten versüßten den anbrechenden Abend, Spiele und Glühwein taten das Übrige.
Ich tankte geistige Energie, indem ich mich jenen Menschen zuwandte, die mir, jeder für sich als einzigartiges Wesen aus Lebenserfahrung und Lebensfreude, Kraft schenkten.
Dennoch gingen mir die Gespräche mit Philipp am tiefsten. Vielleicht befanden wir uns gerade auf einer ähnlichen emotionalen Ebene.
Bei Musik mit zu Herzen gehenden Texten, sogenannten Zeitgeistliedern, gestattete ich mir für Momente Bilder, die allein Philipp und mich beinhalten. Ich wurde zum ruhenden, hinnehmenden Ufer, er zum streichelnden, wogenden Meer.
Einmal verschlingen wir uns zu einem großen Ganzen, werden von höheren Mächten auseinandergerissen, um anschließend nur noch viel aufgewühlter und stürmischer miteinander zu verschmelzen.
Es fiel mir nicht leicht, mich von den Phantasien loszureißen. Meine Augen durften nicht zu lange auf ihm ruhen. Seinen Blicken wich ich aus, so gut es ging. Wir waren schließlich verheiratet, hatten beide Kinder und eheliche Verpflichtungen. Als warnendes Signal rief ich mir immer wieder das Bild seiner Familie ins Gedächtnis, um ja nicht vom Pfad der Tugend abzukommen. Waren wir gar auf der Hütte schon reif, einander zum Opfer zu fallen?
Der Himmel hatte sein Sternenzelt ausgebreitet, als eine kleine Gruppe zum Rodeln aufbrach. Bereits nach wenigen Schritten fanden wir beide uns nebeneinander herwandernd, den Hügel erklimmend, wieder. Leider war der Schnee zu nass, so konnten wir nicht auf den mitgebrachten Kunststoffsäcken talwärts rutschen. Ein paar Leute gingen ins Haus zurück, die übrigen unternahmen einen Nachtspaziergang.
Die Schneedecke funkelte, der Mond leuchtete uns den Weg. Ich versprach Philipp Auszüge aus dem Konzept des Sozialprojektes, er wollte mir Musik und Literatur nahe bringen, die ihm besonders viel bedeutete.
Als wir zurückkehrten, ging es schon auf Mitternacht zu und einige tanzten noch ausgelassen zur Musik auf den Holztischen vor der Hütte. Wir setzten uns etwas abseits. Im Schutze der Dunkelheit sprach er dann von Gefühlen und Seelenqualen, die seinen Workaholismus betrafen, der angeblich sein familiäres Leben überschattete, im Besonderen aber seine persönliche Entwicklung stagnieren ließ. Ich hörte ihm aufmerksam zu, war zugleich innerlich aufgewühlt, ja regelrecht schockiert.
Im Bett war meine Müdigkeit wie verflogen. Ich lag noch lange Zeit mit offenen Augen neben der schlafenden Freundin. Unter lautem Getöse rutschte eine Dachlawine ab und nach höchstens zwei Stunden Schlaf stand Skifahren am Programm.
Ich hatte wohl meine physischen Kräfte überschätzt. Fast kein Schlaf, starker Kaffee, kein Bissen im Bauch, dazu kam der Höhenunterschied bei der Fahrt mit der Gondel zur Bergstation. Ich erlitt einen Kreislaufkollaps.
Schweißgebadet, mit zittrigen Beinen auf den Skiern ins Tal rutschend, von ein paar Leuten aus unserer Gruppe zur Absicherung im Konvoi begleitet, erreichte ich die Talstation. Nach einem doppelten Schnaps und einer heißen Suppe im Restaurant stabilisierte sich mein Kreislauf allmählich. Inzwischen tobte sich Philipp auf der Piste aus, die weiblichen Skifans forderten ihn heraus.
Den letzten Tag verbrachte jeder mit seinen Vorlieben. Einige lagen vor dem Haus in der Sonne, lasen, hörten Musik oder diskutierten über Liedertexte. Andere wanderten auf den Hausberg. Philipp verbrachte mit ein paar sportlichen Freaks nochmals einen halben Tag auf der Piste. Mit etwas Wehmut im Herzen reinigten wir gemeinsam Stube, Küche und Zimmer.
Gegen Abend, noch ehe der geschmolzene Schnee zu vereisen begann, brachen wir in einer Kolonne die Heimreise an.
Bereits am frühen Morgen hatte mich Pauls Anruf beunruhigt. Angeblich war unsere Tochter wieder einmal nicht nach Hause gekommen. Ich fuhr mit gemischten Gefühlen heimwärts, ahnte, dass der Anruf lediglich ein Vorbote zu einer längeren Auseinandersetzung gewesen war.
Philipp versuchte, mich abzulenken. Er versprach mir beizustehen, falls es größere Schwierigkeiten geben sollte. Seine Frau habe schließlich schon mit schwierigen Jugendlichen gearbeitet, sie würde bestimmt auch mein Kind bei sich aufnehmen, und er wäre der Letzte, der etwas dagegen hätte.
Diese Aussichten machten mich zuversichtlicher und beruhigten mich während der langen Heimfahrt. Trotz aufheiternder Gespräche, die uns die Fahrt verkürzten, war ich angespannt. Schließlich stand unser ersehntes Fortgehen als krönender Abschluss des Skiwochenendes auf dem Spiel.
Unter dem Vorwand, gemeinsam nach der Tochter zu suchen, holte mich eine Freundin von Zuhause ab. Tanja war inzwischen zwar kurz da gewesen, jedoch gleich wieder verschwunden, als sie gemerkt hatte, dass ich noch abwesend war.
Nachdem wir sämtliche Innenstadtlokale vergebens nach ihr abgesucht hatten, gaben wir die Suche auf. Nicht der geringste Hinweis kam, wo Tanja stecken könnte, denn ihr neuer Freundeskreis hielt dicht.
Inzwischen wartete der harte Kern unserer Gruppe in einer Diskothek auf uns.
Bitte E-Book-Format wählen:
Nur geträumt?
Ein Roman von Christine Lackner
Labels:
Nur geträumt,
Sirius Verlag,
Weihnachten,
Weihnachtsgeschenk
Freitag, 10. Dezember 2010
Roman-Neuerscheinung: Wurzeln der Hoffnung
 |
| Wurzeln der Hoffnung von Miluna Tuani |
Der Roman ›Wurzeln der Hoffnung‹ spielt auf Korsika und erzählt die Geschichte einer jungen Fotografin und Journalistin. Alicia beschließt, ihr Leben zu beenden, da sie unter den Folgen eines schweren Schicksalsschlages leidet. Als sie den Freitod in die Tat umsetzen will, begegnet ihr ein mysteriöser junger Mann. Eine spannungsreiche Beziehung entwickelt sich zwischen den beiden.
 |
| Miluna Tuani |
Autoreninterview mit Miluna Tuani am 20. Oktober
Wann haben Sie zu schreiben begonnen?
Schon als Kind fing ich an, kleine Geschichten aufzuschreiben, die mir in den Kopf kamen, ebenso Gedichte und Liedertexte. Für mich war das Schreiben immer ein Teil meines Seins.
Was bedeutet das Schreiben für Sie?
Meine kreativen Auswürfe in Form von Geschichten mit anderen zu teilen. In den letzten Jahren ist der Wunsch dazugekommen, über Korsika zu schreiben. Ich möchte Verständnis bei deutschsprachigen Besuchern dieser Insel der Schönheit vermitteln, indem ich von ihrer bewegten Geschichte, eigenständigen Kultur und lokalen Sprache, Musik und sozialpolitischen Problemen der modernen Zeit erzähle.
Wann kommen Ihnen die besten Ideen?
Ganz spontan, jederzeit, auf einmal sind sie da.
Woher bekommen Sie Ihre Ideen?
Ich suche nicht nach ihnen, auf einmal habe ich eine komplette Geschichte im Kopf. Aber sicherlich tragen meine Geschichten Züge von Erlebtem gemischt mit meiner Fantasie.
Haben Sie eine Marotte beim Schreiben?
Ja, ich kann nur schreiben, wenn totale Ruhe um mich herum herrscht, sprich nachts!
Wie sieht Ihr Schreibzimmer aus?
Ich arbeite an meinen einfachen PC-Rollentisch in meinem spartanisch eingerichteten Wohnzimmer: Sofa mit Couchtisch, Esstisch mit Stühlen, Rattanregal, Kaminnische, Amerikanische Küche, gelb-beige hohe Wände, eine Treppe zum Mezzanin.
Ihr Fensterblick?
Auf die Terrasse, in den Garten, mit Blick auf die umliegenden Berge von dem Terrassentürfenster aus; vom anderen auf das Dorf und das Meer, am Horizont Elba und Capraja manchmal – je nach Wetterlage.
Ist Ihre Zimmertür offen, wenn Sie schreiben?
Zu im Winter, da ich im Salon schreibe und es sich um die Terrassenfenstertür handelt; im Sommer auch offen. Aber wegen der Füchse bevorzuge ich es, die Fensterläden zuzumachen. Wir leben in wilder Natur in den Bergen.
Hören Sie Musik?
Ja, beim Überarbeiten der aufgeschriebenen Geschichten, nicht aber bei der Erstfassung.
Schreiben Sie diszipliniert?
Ja, ich habe mein Ziel vor mir und muss es fertigstellen, auch wenn manchmal die ganze Nacht dabei drauf geht. Wenns im Kopf »juckt«, muss die Geschichte raus auf die Festplatte ohne Wenn und Aber und ohne dass man mich stören darf.
Wie gehen Sie mit Schreibproblemen um?
Ich warte auf eine bessere Gelegenheit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, und meditiere über die erfundene Story im Stillen, im Liegen mit geschlossenen Augen und lasse die Handlung wie einen Film vor meinem inneren Auge ablaufen.
Welche Bücher lesen Sie selbst am liebsten?
Historische Romane, Scifi/Fantasy u. v. a. m.
Was lesen Sie zurzeit?
Viele interessante Werke auf Literaturplattformen im Web.
Haben Sie LieblingsautorInnen?
Marion Zimmer Bradley, Noah Gordon, aber auch viele andere.
Haben Sie eine bestimmte Methode?
1. Die Geschichte erscheint im Kopf
2. Aufzeichnung der Geschichte in der Rohfassung
3. Die Überarbeitung
Wie kamen Sie auf die Idee zu ›Wurzeln der Hoffnung‹?
Die Gesamthandlung ist mir auf einmal im Kopf erschienen, ein wenig haben sich reale Erlebnisse mit der Fantasie vermischt. Zum Beispiel habe ich die Überschwemmungskatastrophe am Fluss Fium-Altu live miterlebt!
Wie ist dieser Roman dann entstanden?
Nachdem ich die Idee komplett im Kopf hatte, fing ich an, sie in der Rohfassung aufzuschreiben, das war 1995. Dann folgten einige Jahre Kinderpause. Im Jahr 2003 nahm ich das Manuskript wieder zur Hand und bearbeitete es bis zu seiner endgültigen Fassung.
Wie sind Sie handwerklich-technisch herangegangen?
Nachdem ich die Rohfassung niedergeschrieben hatte, erstellte ich ein Konzept, um den Roman logisch zu gliedern. Ich fertigte ein Exposé an, teilte den Roman in Kapitel und Unterkapitel mit je einer kurzen Inhaltsangabe, anschließend folgten Personenbeschreibungen der Haupt-und Nebencharaktere mit ihrer Biografie.
Das war unter anderem die Arbeit für eine Hausaufgabe innerhalb meines Fernstudiums ›Schreiben lernen‹, das ich von 1992-1993 hier vor Ort absolvierte. Dieses Gerüst habe ich dann meinem Onkel, einem ehemaligen Germanistikprofessor, zum Lektorat vorgelegt. Seine lektorierte Version habe ich erneut abgespeichert. Bei einer Informatikpanne habe ich jedoch diese lektorierte Version leider verloren und musste so noch einmal von vorne angefangen!
Wussten Sie von Anfang an, wie es ausgeht?
Ja.
Erkennt man in der Endfassung noch die Rohfassung?
Es gab einige Überarbeitungen, aber die Rohfassung blieb gut erkenntlich. Mein Onkel wollte einige Abschnitte völlig weglassen, aber ich war dagegen, da ich meinen Roman als Gesamtwerk sehe. Es ist wie bei einer Symphonie: Wenn man ein Stück herausnimmt, bricht die Harmonie zusammen. Er verstand das, blieb aber skeptisch wegen einiger Szenen.
Wie kamen Sie auf die Namen der Figuren?
Sie sind mir ebenso erschienen wie der Text selbst.
Haben Sie vor Ort recherchiert?
Nein, da ich vor Ort lebe und ihn sehr gut kenne.
Gab es Motivationslöcher, wie haben Sie sich daraus befreit und wie über Schreibblockaden hinwegmanövriert?
Die Informatikpanne hat mir sehr die Motivation genommen, aber da ich ein sogenanntes Stehaufmännchen bin, habe ich mich erneut daran gesetzt. Ich habe aber etwas Zeit vergehen lassen, inzwischen andere Texte aufgezeichnet und ein wenig Abstand genommen.
Musste Ihre Umwelt leiden, während Sie am Buch gearbeitet haben?
Kaum, da ich ja nachts schreibe.
Wie ist es, nach all den Mühen, den Roman veröffentlicht zu bekommen?
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das ich irgendwie nicht in Worte fassen kann, nur, ich bin sehr froh und stolz darauf und dankbar.
Wohin reisen Sie gerne und was ist für Sie an einem Urlaubsort wichtig?
Bevor ich mich endgültig auf Korsika ansiedelte, reiste ich viel herum schon von klein auf, aber mein Lieblingsreiseziel blieb immer die Insel Korsika.
Wichtig ist für mich an einem Urlaubsort das angenehme Klima, wilde, unbelassene Natur und wenig überlaufende Orte fern vom Massentourismus.
An welchem Text arbeiten Sie derzeit?
Ich bin zurzeit mit der Überarbeitung meiner Endzeittrilogie beschäftigt, deren Erstfassung ich vor ca. fünf Jahren auf Festplatte brachte, sowie mit meinem ersten Roman von 1990/91, dessen Original ich auch in einer Informatikpanne verloren habe.
Ich bin auf diese Weise vom Pech verfolgt gewesen, aber heute ist zum Glück mein Sohn ein Informatikgenie, das heißt, er findet für jede Panne eine Lösung. Er ist zwölf!
Auch möchte ich alle meine anderen alten Werke überarbeiten, um sie für eine eventuelle Veröffentlichung vorzubereiten.
Wissen Sie schon, wie der neue Roman heißen wird?
Meine Endzeittrilogie heißt ›Astreya‹ und mein erster Roman heißt ›Wie Blätter im Wind‹.
Können Sie schon ein wenig darüber verraten?
›Astreya‹ beginnt in der Vergangenheit, setzt sich in der heutigen Zeit fort und endet in der Zukunft und spielt wieder auf Korsika.
›Wie Blätter im Wind‹ ist ein Unterhaltungsroman und spielt natürlich auch auf Korsika, zwischen gestern und heute, zwischen Schicksal und Vorherbestimmung, zwischen grausamer Realität und übernatürlichen Wahrnehmungen, zwischen Vendetta und politischen Fehden. Und er ist die Einleitung zu einem meiner Erstlingswerke, das ich im Alter von acht Jahren in der Rohfassung erstellt habe, einer SF-Fantasy-Saga in neun Bänden.
Ansonsten habe ich so viele Projekte, die als Exposé oder als Ideenaufzeichnung daliegen. Hätte ich genug Zeit, nur zu schreiben, dann würde ich ein wenig schneller vorankommen. Aber leider hat man ja auch andere Verpflichtungen im Leben. Dank der modernen Technik und den Literaturplattformen ist es mir gelungen, einige meiner spontanen neuen Werke für interessiertes Publikum lesbar zu machen, was mir sehr wichtig ist. Ich bin sehr glücklich, wenn meine Texte gelesen werden und den LeserInnen gefallen.
Herzlichen Dank für das Interview!
Wurzeln der Hoffnung
Ein Roman von Miluna Tuani
Labels:
E-Book,
Korsika,
Miluna Tuani,
PDF,
Reader Roman,
Roman,
Sirius Verlag,
Wurzeln der Hoffnung
Mittwoch, 1. Dezember 2010
Weihnachtsstress ade?
Geht wahrscheinlich nicht. Aber zwischendurch ein Stündchen im frisch gefallenen Schnee herumspazieren, abends eine kleine Kerze anzünden. In aller Ruhe Lesestoff herunterladen, sich Zeit nehmen. Entspannen beim Lesen.